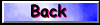Weymayr,Christian / Koch, Klaus: Mythos Krebsvorsorge. Schaden und
Nutzen der Früherkennung. Eichborn Verlag, Frankfurt/Main (März) 2003, 299 Sseiten.
US-Präsident Richard Nixon setzte vor über 30 Jahren
die unvorstellbare Summe von 330 Millionen Dollar in Bewegung, um den Krebs
"ein für allemal" zu besiegen. Drei Jahrzehnte später ist nüchtern
zu konstatieren, dass der Kampf noch nicht verloren ist, aber auch nicht
gewonnen wurde. Die Krebsmortalität (Krebstote pro 100 Gestorbene)
stieg zwischen 1960 und 2000 in der Bundesrepublik von 17 auf 25. Seit
Mitte der 90er Jahre ist der Anstieg in der Bundesrepublik immerhin zum
Stillstand gekommen. Die altersstandardisierte Krebsmortalitätsrate
(Tote pro 100 000 in einer bestimmten Altersgruppe) sinkt seitdem leicht.
Hat die Krebs-Früherkennung daran einen Anteil? Ärzte wie
Laien werden die Frage mit Ja beantworten. Die beiden Wissenschaftsautoren
und Biologen Christian Weymayr und Klaus Koch beantworten sie mit einem
nicht gerade absoluten, aber doch ziemlich weitreichenden Nein. Die Früherkennung
halte nicht, was sie verspricht, betonen die beiden Autoren in ihrem 300
Seiten starken Buch. Von der Deutschen Krebsgesellschaft, einigen medizinischen Fachverbänden
und von Ärzten werde versprochen, dass die Krebs-Früherkennung
die Überlebenschance erhöht und zu einer Heilung führt.
Weymayr und Koch legen detailliert dar, dass keines der weltweit eingeführten
Krebs-Früherkennungsprogramme dafür einen zuverlässigen
Beweis erbracht hat (S.54). Die Hauptbotschaft des Buches lautet allerdings
nicht, dass die Teilnahme an Früherkennungsprogrammen Unsinn wäre,
vielmehr: Wer nicht zur Früherkennung geht, brauche kein schlechtes
Gewissen zu haben (S.62).
Die Krebs-Früherkennung, die es für Brustkrebs beispielsweise
schon gut 100 Jahre gibt, hatte kaum Einfluss auf die Todesrate. Die Vorstellung,
es ließen sich Menschenleben mit der Früherkennung retten, scheint
ein schöner Selbstbetrug zu sein. Weiterhin werden Herz-Kreislauf-Erkrankungen
und Krebs die (in Deutschland sehr ungenaue) Todesursachenstatistik anführen.
Entscheidend dabei ist, in welchem Alter sie das tun. Die Statistik sagt,
dass das Sterbealter für Krebs in aller Regel über dem Sterbealter
für Herz-Kreislauf-Erkrankungen liegt. Wer Krebs hat, lebt länger,
wenngleich nicht unbedingt angenehmer. Krebs kann ein langer Prozess sein,
während Herz- und Hirnschlag eher (aber nicht immer) einen raschen
Tod zur Folge haben.
Krebs ist im Großen und Ganzen eine Alterserkrankung, immer mehr
Menschen werden alt genug, "ihren" Krebs in voller Blüte zu erleben.
Er wird durch viele Faktoren beschleunigt, vor allem durch Rauchen, eine
genetische familiäre Disposition, Viren, bestimmte Chemikalien, UV-Licht,
Asbest und Röntgenstrahlung. Stress, Sorgen und traumatische Erlebnisse
beeinflussen die Entwicklung eines Tumors nicht messbar - wenn überhaupt.
Die Gesamtzahl der Krebserkrankungen und -todesfälle nimmt zu, einfach
weil die Menschen älter werden und immer mehr ältere Menschen
leben. Die schlechte Nachricht ist, dass der Tod mit immer größerer
Wahrscheinlichkeit nicht schnell kommt, sondern eine immer längere
Zeitspanne vor dem Tod eine Zeit der chronischen Erkrankung ist.
Was wir in den Industriestaaten erleben, ist ein langsamer Austausch
der Todesursachen. Noch vor 50 Jahren starben die meisten an Infektionskrankheiten.
Dann wurden Pocken ausgerottet und andere infektiöse Erkrankungen
mittels Kühlschränken, sauberem Trinkwasser, Impfung und Antibiotika
stark zurückgedrängt. Da die Sterberate immer 100 Prozent beträgt
("Auf lange Sicht sind wir alle tot"), müssen andere Todesursachen
nach vorne rücken, nur dass jetzt der Todeszeitpunkt nach hinten rutscht.
Epidemiologen und Krebsspezialisten wie der Präsident der Deutschen
Krebsgesellschaft, Klaus Höffken, rechnen damit, dass 2015 Krebs die
Todesursache Nr. 1 sein wird. Höffken sagt das mit einem alarmierten
Unterton und ruft zur Früherkennung auf, doch mit Weymayr und Koch
zu sprechen scheint sein Argument dafür falsch zu sein. Wenn Krebs
demnächst Todesursache Nr. 1 sein wird, dann bedeutet das gleichzeitig,
dass tödliche Herz-Kreislauf-Krankheiten zurückgedrängt
sein werden. Krebs als Todesursache Nr. 1 verspricht ein längeres
Leben, wenn auch nicht unbedingt einen angenehmeren Tod. Früherkennung
ist der aufwändige Versuch, den Todeszeitpunkt für Krebs noch
weiter nach hinten zu verschieben.
Aber wird der Todeszeitpunkt überhaupt nach hinten verschoben?
Die Autoren sagen Nein. Die Krebs-Früherkennung wird die Todesursache
Krebs nicht aufhalten. "Es ist unbekannt, ob die Früherkennung wirksam,
sicher und wirtschaftlich ist", meint Dieter Hölzel vom Tumorregisterzentrum
München. Der Früherkennung wird schon deswegen kein großer
Erfolg beschieden sein, weil Krebs nicht besonders weit verbreitet ist.
Eine 60-jährige Frau hat ein Risiko von 0,7 Prozent, in den nächsten
10 Jahren an Brustkrebs zu erkranken. Ein 60-jähriger Mann hat ein
Risiko von 0,4 Prozent, in den nächsten 10 Jahren an Prostatakrebs
zu sterben. Wenn das Risiko selbst bei diesen beiden häufigsten Krebsarten
so klein ist, warum sollte man dann an den Früherkennungsprogrammen
teilnehmen, zumal festzustehen scheint, dass jene, die daran teilnehmen,
im Schnitt genau so lange leben wie jene, die die Früherkennung ignorieren?
Das generelle Problem bei der Früherkennung ist ein nicht aufhebbares
statistisches Problem: Um jene kleine Zahl von Krebserkrankten zu finden,
müssen enorme Massen von Gesunden untersucht werden, Screening genannt.
Weil die Gesunden immer weit in der Überzahl sind, löst Früherkennung
wesentlich häufiger Fehlalarm bei Gesunden aus als einen korrekten
Alarm bei Krebserkrankten. Wie viele falsche Diagnosen mit teilweise eingreifenden
Folgeuntersuchungen (Biopsien z.B.) will man in Kauf nehmen für einen
richtig erkannten Krebs?
Wenn durch Mammografie-Screening nur ein Drittel aller Brustkrebstumore
frühzeitig erkannt, behandelt und geheilt werden können, verringert
sich das Risiko einer 60-Jährigen, in 10 Jahren doch noch an Brustkrebs
zu sterben, von 0,7 auf 0,46 Prozent. Das sind ungefähr zwei Krebstodesfälle
unter 1000 60- bis 70-Jährigen weniger. Zur Verlängerung zweier
Frauenleben um je zehn Jahre müssen aber alle 1000 Frauen gescreent
werden.
Angenommen, es gelingt wirklich, durch ein ausgeweitetes Screening-Programm
ein Drittel aller Brustkrebse zu heilen, was aus verschiedenen Gründen
unwahrscheinlich ist, dann vermindert sich das allgemeine Risiko für
60-Jährige, in den kommenden 10 Jahren an irgendeiner Krankheit
zu sterben, von 10,5 Prozent auf 10,3 Prozent. Das gilt für Nichtraucherinnen.
Für 60-jährige Raucherinnen verringert sich das 10-Jahres-Sterberisiko
von 19,9 auf 19,7 Prozent. Das bedeutet: Würde keine Frau mehr rauchen,
würden innerhalb von 10 Jahren unter 1000 Frauen in 89 Fällen
vorfristiges Ableben vermieden werden (immer auf die 60-jährigen bezogen),
bei einem flächendeckenden Mammografie-Screening zwei.
Für die Männer wäre der Verzicht auf das Rauchen noch
viel dramatischer. Bei den 60-jährigen würden von 1000 dieser
Altersgruppe um die 200 nicht innerhalb von zehn Jahren sterben. Diesen
rund 200 stehen ein bis zwei gerettete Leben durch eine flächendeckende
Prostata-Früherkennung gegenüber. Mit anderen Worten, der Effekt
von Krebs-Früherkennung kann nur minimal sein. Lohnen sich dann die
gigantischen Ausgaben für Früherkennung überhaupt? Und gibt
es überhaupt einen positiven, zahlenmäßig belegbaren Effekt?
Die Autoren sagen Nein.
Sie zitieren die Ergebnisse von acht Studien zur Brustkrebsfrüherkennung
mit zusammen einer Million Probandinnen, aus denen hervorgehe, dass untersuchte
Frauen seltener an Brustkrebs sterben, aber insgesamt keine höhere
Lebenserwartung haben als jene Frauen, die nicht am Screening teilnehmen.
Die Teilnahme verlängerte das Leben nicht. Das kann statistische Ursachen
haben. Von 1000 beteiligten Frauen zwischen 50 und 70 starben in einer
Studie innerhalb von 10 Jahren vier an Brustkrebs und 96 an anderen Krankheiten.
Der Einfluss der "anderen Krankheiten" ist so groß, dass eine Schwankung
bei Brustkrebs kaum ins Gewicht fällt. Und selbst die Erfolgsmeldung,
"der Anteil der Brustkrebstodesfälle sank um ein Viertel", bedeutet
nicht anderes, als dass jetzt drei an Brustkrebs starben und 96 an anderen
Krankheiten. Immerhin, das Mammografie-Screening führte zu einem Rückgang
von 100 auf 99 Tote.
In Deutschland sind 2003 neue, bessere Standards für das Mammografie-Screening
eingeführt worden, weil die Ergebnisse vorher einfach zu schlecht
ausfielen. Ungefähr 45 000 Frauen erkranken bei uns jährlich
neu an Brustkrebs, rund 18 000 sterben daran, das sind vier Prozent aller
weiblichen Verstorbenen. Zum Zeitpunkt der Diagnose sind sie im Schnitt
63,5 Jahre alt, das durchschnittliche Sterbealter liegt bei 70, die durchschnittliche
Lebenserwartung der Frau liegt zur Zeit bei 79 Jahren. Da 96 von 100 Frauen
nicht an Brustkrebs sterben, kann eine Früherkennungsmaßnahme
auch nicht ihr Leben retten. Das setzt dem Screening Grenzen. Die Frauen,
die sich selbst die Brust abtasteten, starben ebenso oft an Brustkrebs
wie jene, die es ließen, referieren Weymayr und Koch (S.130). Tastuntersuchung
plus Mammographie verbessert das Ergebnis nicht, wie aus einer kanadischen
Untersuchung hervorgehe.
Was die Genauigkeit der Untersuchungsmethode angeht, so wurde herausgefunden,
dass Ärzte beim Abtasten 40-50 von 100 Tumoren übersehen. Entscheidend
ist hier die Größe: kleine werden übersehen und wachsen
heran bis zu einer Größe, wo sie ertastet werden können,
aber schlechter zu heilen sind. Wird "etwas gefunden", so heißt dass,
dass die Diagnose mit anderen Verfahren verfeinert werden muss, denn in
96 von 100 Fällen ist Studien zufolge die erste positive Diagnose
ein Fehlalarm. Wer sich auf Früherkennung einlässt, muss eine
recht hohe falsch-positive Befundung in Kauf nehmen. Und er muss in Kauf
nehmen, dass in etwa 10 bis 40 Prozent der Fälle ein Tumor übersehen
(falsch-negativ) wird - weil er zu klein, der Arzt unerfahren oder die
Technik veraltet ist.
An Prostatakrebs erkranken jährlich in Deutschland 30 000 und sterben
jährlich 11 600 Männer. Das durchschnittliche Todesalter liegt
paradoxerweise bei 77,6 Jahren, das mittlere Sterbealter für Männer
beträgt 70 Jahre. Seit 1971 steht in Deutschland jedem Versicherten
vom 45. Lebensjahr an ein Abtasten der Prostata vom After aus zu. Im Jahr
1990 wurden bei 1,4 Millionen abgetasteten Männern mehr als 3000 verdächtige
Befunde erhoben, von denen sich 428 bestätigten. Über 2500 mal
gab es falsch-positiven Fehlalarm. Bei gut 30 000 neuen Tumorfällen
werden durch das Abtast-Screening somit nur einer von 70 Tumoren entdeckt.
Die Mehrzahl der tastbaren Tumore sind fortgeschrittene, große Tumoren.
Auf 100 erkannte Tumore kommen 50 bis 500 unerkannte, sagt die American
Cancer Society.
Bei Prostatakrebs gilt der so genannte PSA-Wert als zweiter Hinweis.
Er lässt sich recht einfach durch einen Bluttest ermitteln. Doch auch
hier gelte, "eine Senkung der Todesrate durch das PSA-Screening ist unbewiesen"
(S.150). Ab einem Wert von 4 Nanogramm pro Milliliter Blut sollte der Arzt
aufhorchen. Der Wert kann allerdings nur ein erster Hinweis sein, denn
eine Erhöhung wird auch durch eine gutartige Vergrößerung
oder eine Entzündung hervorgerufen. Außerdem schwankt der PSA-Wert
deutlich - unter Gesunden wie unter Kranken. Auf 100 richtig erkannte Tumore
kommen 25 bis 250, die durch PSA übersehen werden.
Das bedeutet weitere Untersuchungen, in der Regel eine Biopsie. Unter
1000 Biopsien kommt es zu 3 bis 50 Infektionen, 6 Blutvergiftungen und
einer schweren Blutung. Wenn der positive Befund bestätigt wird, besteht
die Behandlung in Operation oder Bestrahlung. Ärzte wissen derzeit
nicht, ob Operation oder Bestrahlung die Sterblichkeit positiv beeinflusst
und reinem Zuwarten überlegen ist. Eine operative Entfernung der Prostata
führt nach Angaben der Buchautoren in 2 bis 10 von 1000 Fällen
wegen Komplikationen bei den oft älteren Männern zum Tode.
Eine gravierende Nebenwirkung bei geglückter Operation ist der
Verlust der Potenz sowie Inkontinenz; ein Viertel aller Operierten können
zumindest in der Zeit nach der Operation ihr Wasser nicht mehr halten und
müssen Windeln tragen. Das Problem Inkontinenz tritt bei der Bestrahlung
nicht auf, aber 40 bis 67 Prozent werden impotent. Zudem ist aus Obduktionen
bekannt, dass ein Drittel aller Männer ab 50 und jeder zweite Mann
ab 80 einen Prostatatumor in sich trägt, wenngleich nur ein kleinerer
Teil zu Lebzeiten entdeckt wurde. Vorstufen des Tumors finden sich in fast
jedem zehnten 20- bis 30-jährigem. Das lasse den Schluss zu, schreiben
die Autoren, dass sich ein Prostatatumor über Jahrzehnte entwickelt
und in den meisten Fällen unentdeckt bleibt. Wenn die unterschiedlichen
Screening-Methoden in Anspruch genommen werden, so werden sehr viele Tumore
übersehen und sehr viele Befunde zunächst fälschlich als
Tumor diagnostiziert. Von 100 diagnostizierten Tumoren führen Schätzungen
zufolge nur 7 tatsächlich zum Tode in einem hohen Alter. Ob in diesen
Fällen die Therapie wirklich hilft, ist ungewiss. "Bislang lässt
sich nicht beurteilen, ob dass Screening unter dem Strich tatsächlich
Menschenleben rettet", fassen die Autoren zusammen (S.172).
Die Darstellung, auch für die übrigen Krebsarten, zu denen
kein Früherkennungsprogramm existiert, ist beeindruckend. Ausführlich
wird die Psychologie des Früherkennungs-Verweigerers analysiert, die
Beziehungsgeflechte von Kassen, Patienten, Ärzten, Pharmaunternehmen
und Selbsthilfegruppen durchleuchtet und die Vor- wie Nachteile aller Früherkennungsangebote
gegeneinander abgewogen. Alle relevanten und bekannten Fakten werden nüchtern
abgewogen.
Der Lesefluss wird nicht durch Anmerkungen unterbrochen, doch just diese
Lesefreundlichkeit führt zu einem schwerwiegenden und bedenklichen
Mangel. Im Anhang des Buchs sind die benutzen Werke und Internetadressen
kapitelweise aufgelistet, aber die bloße Nennung verhindert das Auffinden
und das eventuelle eigene Überprüfen der Quellen. Den Leser beschleicht
die bange Frage, ob die Autoren die Studien wohl alle korrekt zitiert haben?
Auf eine genaue Beschreibung der zitierten Untersuchungen und eine kritische
Diskussion ihres Ansatzes und ihrer Ergebnisse lassen sie sich nicht ein.
Darin liegt die größte Schwäche dieses Buches. Es kann
nicht ausgeschlossen werden, dass andere mögliche Interpretationen
von Studienergebnissen die recht klaren und eindeutigen Aussagen von Weymayr
und Koch verwässern, vielleicht sogar aufheben. Die Autoren haben
dem Mangel teilweise abgeholfen, indem sie im Internet die Verknüpfungen
zu recht vielen der herangezogenen Studien anbieten.
Kleinere Mängel indes lassen sich eher verschmerzen. Nur einen
Satz zum Bakterium Helicobacter und seiner Eliminierung als mögliche
Vorbeugung gegen Magenkrebs ist zu dürftig. Schließlich fehlt
ein Resümee, eine Zusammenfassung für den eiligen Leser und als
Gedächtnisstütze. Die Autoren sollten die Chance bekommen, in
einer zweiten Auflage die Lücken zu schließen. Dann aber könnte
dieses Buch das Standardwerk für den Laien in Fragen der Krebs-Früherkennung
werden.
Das Buch ist für zwei Gruppen von Menschen bedeutsam, für
jene, die vor der Frage stehen, ob sie an einer Früherkennung teilnehmen
sollen, und jene, denen ein positives Testergebnis mitgeteilt wurde: "Sie
haben Krebs!" Früherkennung heilt nicht und schiebt nicht den Tod
auf, sondern verlegt den Diagnosezeitpunkt nach vorn. Wer früher erkannt
wird, kann eventuell besser geheilt werden, um länger zu leben - und
einem zweiten oder dem gleich Krebs Zeit zu geben, sich zu entwickeln.
So paradox es klingt, die Krebs-Früherkennung trägt ein wenig
dazu bei, dass sich die Zahl der
Krebstoten erhöht (nur dass sie später sterben). Entscheidend
an der Früherkennung ist also nicht die Zahl der erkannten Krebserkrankungen,
sondern ob die erkannten Erkrankten länger leben als die nicht erkannten.
Und das eben scheint nicht gegeben.
Dennoch verbreitet die Deutsche Krebshilfe unverdrossen die Botschaft:
"Die wichtigste Rolle im Kampf gegen Krebs spielt nach wie vor die Früherkennung."
Man darf gespannt sein, wie die Deutsche Krebshilfe und andere Fachärzte
auf dieses Buch reagieren werden.
Gerald Mackenthun 
Berlin, März 2003
direkt bestellen:

Mythos Krebsvorsorge.
Schaden und Nutzen der Früherkennung