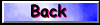Günter Weier (Hrsg.): Leben heißt, Schwierigkeiten überwinden.
Tiefenpsychologische Betrachtungen zur Psychohygiene im Alltag. Quercus-Verlag,
Berlin 2001
Der Leser wird heute überschwemmt mit einer Fülle
von Tipps und Tricks zur körperlichen Gesundheit und Fitness. In aller
Regel wird dabei übersehen, dass der Mensch eine Einheit ist, die
neben dem Körperlichen auch das Geistige und Seelische umfasst. Wie
soll sich jemand in der Sphäre des Geistes entwickeln? Diese wichtige
Frage wird auf den Seiten der Journalen kaum je erörtert. Die Autoren
dieses Bandes, die allesamt dem Institut für Tiefenpsychologie in
Berlin assoziiert sind, versuchen auf 266 Seiten diese Lücke zu füllen.
Die Aufsatzsammlung beginnt mit einem Paukenschlag: mit der Frage nach
dem Sinn des Lebens. Der Individualpsychologe Alfred Adler hat dieser Frage
1933 ein Buch gewidmet und der Autor Günter Keesen geht ausführlich
darauf ein. Einige Menschen sehen den Sinn des Lebens darin, zu dominieren
und zu herrschen, eine zweite Gruppe erwartet viel von anderen und kultiviert
das Nehmen, die Dritten sehen den Sinn des Lebens darin, sich durch Vermeidung
von Aufregung und Verantwortung ein ruhiges Lebens zu machen, und eine
vierte Gruppe sieht den Sinn des Lebens in Kooperation und konstruktiver
Beitragsleistung. In unseren Werken für die Allgemeinheit drückt
sich der Sinn unseres Lebens aus. Die Art dieser Beitragsleistung wird
nicht konkretisiert, doch wird hinreichend deutlich, dass sie gemeinschaftlich
und sozial orientiert sein muss, um als wertvoll anerkannt werden zu können.
Sinnsuche und –beantwortung braucht dabei nicht zu hoch angesetzt werden.
Vernunft, Vorurteilsfreiheit und Tüchtigkeit zeigen sich im direkten
Umgang mit den Mitmenschen und den Lebensaufgaben. Adlers Sinnverwirklicher
ist leistungsorientiert, sowohl nach außen als auch in der Selbstvervollkommung.
Referiert Keesen weitgehend, so steigt Reinhold Köpke argumentierend
in den schwierigen Begriff der „Zufriedenheit" ein. Die psychologischen
Schulen haben dazu wenig bis nichts zu bieten und auch die Philosophie
hat sich mit diesem Lebensgefühl nur am Rande befasst. Nach Freud
wäre Zufriedenheit ein kurzer Zustand der Homöostase, der durch
die biologischen Triebbedürfnisse immer wieder ins Wanken kommt und
neu hergestellt werden muss. Nach Alfred Adler ist der primäre Zustand
des Menschen nicht einer der Zufriedenheit, sondern prägend sei das
Gefühl der Unzulänglichkeit und Minderwertigkeit. Wie ein Trieb
will der Mensch aus diesem Mangelzustand heraus. Wenn der Mensch Geltung
erlangt hat und anerkannt wird, mag er zufrieden sein, aber ausgeführt
hat Adler diesen Gedanken nicht. Köpke entwickelt deshalb auf eigene
Faust eine Struktur der Zufriedenheit mit einigen erhellenden Gedanken,
u.a. dem, dass als Folge von (anerkannter) Leistung sich Zufriedenheit
einstellen mag.
Rüdiger Schlott betont in seinem Rückgriff auf Lebensgestaltung
in der Antike den „Moment der Unverfügbarkeit", den das Handeln im
Leben immer begleitet. Natürliche Anlage und menschliche Anstrengung
mögen gegeben sein, doch wenn die Gunst des Gottes, der Zufall oder
die Situation nicht mitspielen, bleiben Anlage und Anstrengung wirkungslos.
Die Bezüge der Psychoanalyse und der Individualpsychologie zur Antike
sind eher dürftig. Der Ödipus-Komplex, den nach Freud angeblich
alle Menschen zwischen dem dritten und fünften Lebensjahr durchlaufen,
hat mit der antiken Sage nichts mehr gemein. Bei der Individualpsychologie
Alfred Adlers kann Schlott einige Parallelen zur antiken stoischen Schule
aufzeigen. Für beide sind Tatsachen und Schicksale nichts, die Meinungen
darüber alles; wer seine falschen Meinungen aufgeben kann, wird auch
nicht leiden - eine problematische Haltung, da sie Veränderungen und
Entwicklung ausschliesst.
Das stoische Hinnehmen des Gegebenen verschwand im Zuge von Demokratisierung
und politischer Teilhabe an der Gesellschaft sowie mit der Herausbildung
einer Individualität, die „wirkmächtig" sein möchte. Schon
das kleine Kind freut sich an dem, was es bewirkt, und Antonovsky (der
Erfinder der Salutogenese) hält die Zuversicht, dass es Möglichkeiten
der Bewältigung von belastenden Ereignissen gibt, für einen entscheidenden
Gesundheitsfaktor. Antonovskys Salutogenese konnte sich nicht durchsetzen,
weil Gesundheit eben nicht einfach komplementär zur Krankheit ist,
wie Gadamer feinsinnig ausgeführt hat. Irgendwo zwischen Krankheit
und Gesundheit ist Neurose angesiedelt, wie Gerald Mackenthun für
Freuds Psychoanalyse und Adlers Individualpsychologie darlegt. Sie haben
jeweils spezifische Vorstellungen von Gesundheit, ebenso wie die Daseinsanalyse
und Rattners Personalismus, die jeweils kurz vorgestellt werden. Person
ist das vernünftige und zurechnungsfähige Wesen, das freiwillig
unter moralischen Gesetzen steht. Gesundheit ist also nicht nur etwas Physiologisches,
sondern reicht weit in die Psyche und in die Wertewelt hinein.
Günter Weier, der Herausgeber, macht einen Sprung in die Psychotherapie
und erzählt sehr lebendig, was dort passiert und womit Analysanden
und Klienten rechnen können. Das Ganze ist eingebettet in theoretische
Überlegungen zur Psychotherapie und ergibt insgesamt einen ausgezeichneten
ersten Einblick in das, was einen in einer tiefenpsychologischen Psychotherapie
erwartet.
In die Niederungen von Ehe und Partnerschaft und ihren Streitigkeiten
steigt der Beitrag von Gisela Greulich-Jansen hinab. Die Quellen für
Irritation und Missverstehen sind endlos und die Autorin kann sie jeweils
nur anreißen. Sie plädiert für gegenseitige Toleranz und
Geduld sowie für innere produktive Selbsterforschung als Gegenmittel.
Mehr als abstrakte Lebensweisheiten kann der kurze Beitrag nicht geben.
Zudem ist fraglich, ob die „innere Entwicklung" ein gutes Mittel gegen
Streit und Zerwürfnis ist. Stil, Richtung und Inhalt von Selbstwerdung
werden immer umstritten sein. Wann arten Kompromisse in Beliebigkeit aus?
Wann kippt Toleranz in Gleichgültigkeit um? Ab wann blockiert Nachgiebigkeit
jede notwendige Entscheidung? Wann wird Anpassungsfähigkeit zur Gesinnungslosigkeit?
Auf solche Fragen kann oftmals selbst eine langjährige Therapie keine
Antworten geben.
Der Eifersucht widmet sich Gisela Schwarz. Sie leitet ihren Aufsatz
ein mit dem Beispiel von Othello, der durch Jago eifersüchtig gemacht
wird. Othello gilt als der Prototyp des Eifersüchtigen. Meines Erachtens
wird zu wenig die Situation gesehen: Jago erzeugt in Othello aus Neid auf
dessen militärischen Erfolgen die Eifersucht. Shakespeares Drama beginnt
zumindest mit Neid und Intrige, die in Eifersucht fortgeführt wird.
Ohne Neid und Intrige wäre Othello nicht eifersüchtig geworden.
Die Eifersucht wird induziert, was in der Interpretation dieses Dramas
meist übersehen wird, auch bei Schwarz. Andererseits gelingt Jagos
Plan so einfach, weil es ihm mühelos gelingt, Othello eifersüchtig
zu machen. Der Betrachter mag an Othellos feste und sichere Liebe kaum
glauben. Othello ist stärker im Verdächtigen als im Lieben. Wie
schon bei Greulich-Jansen wird wohlverstandene Selbstverwirklichung als
fast alleiniges Mittel gegen Eifersucht und Neid genannt, doch übersehen,
dass beides durchaus nebeneinander existieren kann, wie Schwarz am kurz
erwähnten Beispiel Fontanes selbst erwähnt. Im übrigen wird
aber die Eifersucht durch viele kluge Beobachtungen einsichtig gemacht.
Der gelingenden Sexualität spürt Hermann Schuppenhauer nach.
Gemäß der Adlerschen Hypothese ist die Sexualität Ausdruck
eines individuellen Lebensstils, welcher sich wiederum entwickelt aus einem
mehr oder minder starkem Minderwertigkeitsgefühls des Kindes. Diese
theoretische Grundlage stellt ein Problem dar: Wenn nicht in allen Kindern
ein Minderwertigkeitsgefühl zu entdecken ist, muss dieses bei Adler
so zentrale Gefühl in seiner Bedeutung heruntergestuft werden und
kann folglich für das Sexualleben nicht mehr als unbedingt determinierend
angesehen werden. Andererseits kann nicht geleugnet werden, dass die Erziehung
und das Vorbild der Eltern die Vorstellung von Sexualität und die
dort gezeigten Fähigkeiten oder Störungen entscheidend beeinflussen.
Wie Adler - und die Tiefenpsychologie überhaupt - konzentriert
sich Schuppenhauer auf die Persönlichkeitsstruktur des sexuell Empfindenden
und blendet damit die erzieherische Vergangenheit und die konkrete Situation
(wie auch andere Autoren dieses Bandes) weitgehend aus. Sicherlich wird
ein Mensch, der unter Angst vor Hingabe und Schwäche leidet, zu sexuellen
Störungen tendieren - aber woher kommen die Angst vor Hingabe und
Schwäche? Hemmend wirkt sich zudem aus, dass Adler die Charakterstruktur
des gesunden oder normalen Menschen niemals umfassend beschrieb. Dass Liebe
und Sexualität gelingen, wenn auch die anderen Lebensprobleme produktiv
gelöst sind, mag stimmen, doch scheint damit keine Garantie verbunden
zu sein. Auch sind Konstellationen denkbar, in denen Liebes- und Sexualfähigkeit
nicht Hand in Hand gehen. Schopenhauer hält nach vielerlei Überlegungen
schließlich die Besonnenheit für eine Kardinaltugend, die auch
der Sexualität zu Gute komme. Beispiele für Unbesonnenheit im
sexuellen Verhalten sind vielfältig. Sie zeigt sich u.a. im Umgang
mit dem Problem der Partnerwahl oder der Schwangerschaftsverhütung.
Goethe litt unter Höhenangst und Schwindelgefühl und er bekämpfte
dies u.a. damit, dass er auf die höchsten Zinnen des Strassburger
Münsters kletterte und von dort herab schaute. Das ist eine klassische
Verhaltenstherapie und hat mit neurotischer Angst, mit der sich Dorothee
Friebus-Gergely beschäftigt, eigentlich nichts zu tun. Insofern taugt
das Beispiel Goethe wenig, um die Hypothese von der menschlichen Grundangst,
verunsichernde Erziehung der Eltern oder mangelhafte Ich-Du-Beziehung zu
exemplifizieren. Für Tiefenpsychologen sind Flugangst oder Platzangst
nur äußere Erscheinung eines tieferliegenden existenziellen
Missverständnisses, das es in der Psychotherapie zu bearbeiten gilt.
Mutterliebe, d.h. die enge Bindung an ein Kind, verbunden mit einem
hohen persönlichen Betreuungsaufwand, ist eine „Erfindung" der Neuzeit.
Jean-Jacques Rousseau hatte entscheidenden Anteil daran, dass Frauen sich
wesentlich intensiver um ihren Nachwuchs kümmerten, als es in den
Jahrhunderten davor der Fall war. Psychoanalyse und Individualpsychologie
missverstanden die gesellschaftlichen Anforderungen an „Mutterliebe" als
naturgegeben oder evolutionär geprägt. Kürzlich hat Sarah
Bluffer Hrdy eindrücklich nachgewiesen, dass Weibchen bzw. Mütter
ihr Engagement für den Nachwuchs stark von ihrem sozialen Umfeld abhängig
machen, was der Vorstellung von unbedingter Mutterliebe den Boden entzieht.
Das männliche Vorurteil von der unbedingten Mutterliebe führte
zur Annahme, dass die Mutter fast allein entscheidend für die seelisch-geistige
Entwicklung eines Kindes ist. In einer überspitzten Formulierung:
Das Kind wird so, wie die Mutter ist. Neben der wichtigen Erkenntnis der
Bedeutung der Mutter für die Erziehung erwuchs damit auch die Gefahr
der Schuldzuweisung und Pathalogisierung der Mütter bei Nichterfüllung
der mütterlichen Funktion. Mangel an Mutterliebe wurde zum moralischen
Defekt. Insbesondere die Psychoanalyse spielt hier eine zwiespältige
Rolle, wie Katharina Kaminski in ihrem Beitrag über Mutterliebe heraus
arbeitet. Es falle auf, dass in der Psychoanalyse ausschließlich Eigenschaften
mit negativem oder sogar psychopathologischem Akzent zur Charakterisierung
der gesunden, liebesfähigen Frau verwendet werden, nämlich Passivität,
Masochismus und Narzissmus. Die überragende Bedeutung der Mutter betont
auch die Individualpsychologie, doch sah Adler auch die Gefahr einer zu
engen Mutter-Kind-Beziehung und ein Eingesperrtsein der Frau in eine enge
Häuslichkeit.
Kaminski setzt sich nicht wirklich mit Freud und Adler auseinander,
denn das würde nur mit Kritik gehen, sondern flüchtet sich zu
Simone de Beauvoir, die das Ideal einer emanzipierten, lebenstüchtigen,
sich selbst bejahenden Mutter entwirft, die am besten der großen
Aufgabe der Erziehung gerecht werden könnte. Die Autorin sieht die
Gefahr einer Überbürdung der Mutterrolle durch zuviel Verantwortung,
Schuldzuweisung oder gar Pathologisierung, weist diese Anforderungen männlicher
Psychologen aber nicht zurück. Das hochinteressante Thema verbleibt
im Theoretischen und erfährt keine Überprüfung an der Praxis.
Ihr interessanter Ansatz, der anders als die anderen Beiträge des
Buches nicht von Freud, Adler oder Rattner ausgeht, verbleibt im
Referieren tiefenpsychologischer Ansätze. Das gilt auch für Beauvoir
und ihr Ideal der emanzipierten Frau. Ob und wie dieses Ideal zu leben
wäre, bleibt leider unerörtert.
In einer kurzen Sichtung der Theorien über das Jugendalter zieht
John Burns das Fazit, dass Jugendliche nach Entwicklung streben und dabei
die freundliche aber feste Führung von Erwachsenen brauchen. Die Erzieher
sollten die Erfahrung vermitteln, dass Schwierigkeiten überwunden
werden können.
Mit dem Ausscheiden aus dem Beruf ergeben sich neue, auch zeitliche
Freiräume. Man kann Bildungslücken schließen, Freundschaften
wieder aufleben lassen oder neue schließen und sich um soziale Belange
kümmern. Die Pflege der menschlichen Solidarität ist einer der
vornehmsten Aufgaben. Hier kann man sich noch einmal verstärkt im
Alter widmen. Marianne Röhl-Schlott versucht den Blick auf ein sinnvolles
Altern zu lenken. Das höhere Lebensalter nach der Pensionierung kann
bei guter Vorbereitung in ein erfülltes Leben münden. Diese positive
Ausrichtung kann die Autorin wählen, weil sie den Haupt- und Kulminationspunkt
des Älterwerdens umschifft: das Sterben müssen. Sie folgt damit
anderen Autoren, die Entwicklungsfähigkeit sehen, „wenn nicht Krankheit,
Armut oder seelisches Leid einen niederdrücken". Aber das ist ja gerade
das Problem: Krankheit, Armut und seelisches Leid werden mit zunehmendem
Alter immer wahrscheinlicher.
Von eigener Art ist ein weiterer Aufsatz in diesem Sammelband von Reinhold
Köpke über Konflikte und Konfliktfähigkeit. Er interpretiert
Freud und Adler auf eigenwillige Art, die nicht von unangenehm berührender
Ehrfurcht vor den Großvätern der Tiefenpsychologie geprägt
ist, was seinen Ausführungen einen erfrischenden Ton gibt, den man
nicht in allen Beiträgen findet. Wie schon in seinem Beitrag über
Zufriedenheit verzichtet Köpke auf die Angabe von Literatur. Hier
denkt einer auf eigene Faust.
Etwas unvermittelt stolpert der Leser dann in einen Essay über
Merleau-Ponty von Irmgard Fuchs-Levy hinein. Was Freud und Adler
mit angreifbarer Scheingewissheit über den Menschen formulierte, hält
Merleau-Ponty in der Schwebe. Der Mensch ist sowohl Körper als auch
Geist, er ist gebunden in der Biologie als auch frei in der Transzendenz,
er ist Materie und Künstler gleichermaßen. Materie, Psyche und
Geist sind nichts Gegensätzliches, sondern gleichzeitig wirkende Bedeutungsebenen.
Das ist eine andere Auffassung als die von Adler, der Neurose als einen
schöpferischen, wenn auch schiefen Akt betrachtet. Im Großen
und Ganzen erschließt sich Merleau-Ponty auf diesen wenigen Seiten
nicht. Er scheint ein schwieriger und schwer zu verstehender Existenzialist
zu sein. Auch bleibt es bei einer skizzenhaften Vorstellung. Eine Diskussion
oder ein Vergleich findet nicht statt.
Herausgeber Weier kommt noch einmal auf Adler zurück, speziell
auf dessen These von der Notwendigkeit des Gemeinschaftsgefühls. Das
Gemeinschaftsgefühl war bekanntlich der Dreh- und Angelpunkt der Adlerschen
Psychologie. Jede seelische Regung wurde daraufhin abgeklopft, ob sie gemeinschaftsdienlich
sei oder nicht. Das es in der Geschichte der Menschheit oftmals an Gemeinschaftsgefühl
gefehlt hat und nach wie vor fehlt, wird niemand bestreiten wollen. Elemente
des Gemeinschaftsgefühls sind Solidarität, Kooperation, Kommunikationsfähigkeit,
Anerkennung von eigener Existenz und Eigenwüchsigkeit (gerade auch
bei Kindern), Gewaltlosigkeit, Gefühlsreichtum, Tüchtigkeit,
weitgehende Aggressionsfreiheit und Interesse an Kultur. In dieser Hinsicht
solle und könne der Mensch sich vervollkommnen, betonte Adler.
Wie viele andere Autoren dieses Bandes verzichtet Weier darauf, Adlers
Postulat auf seine Stichhaltigkeit und Anwendbarkeit hin zu überprüfen.
Adler verwässerte dieses Konzept im Laufe seiner Lehrtätigkeit,
in dem er das Gemeinschaftsgefühl auf eine spätere, ideale Gemeinschaft
verschob. Hätte er die konkrete Anwendbarkeit geprüft, wäre
ihm vielleicht aufgefallen, das unterschiedliche Gemeinschaftsgefühle
in Konflikt treten können. Für solche Fälle hatte Adler
keine Handlungsmaximen parat.
Ohne Zweifel war Adler ein Atheist oder besser gesagt: Über Religion
hat er je kaum nachgedacht. Sie interessierte ihn einfach nicht, obwohl
er im Alter zusammen mit einem Pfarrer das Buch „Religion und Individualpsychologie"
herausgab. In diesem sah er einige Parallelen zwischen einer humanistischen
Religiosität und der Individualpsychologie. Möglicherweise suchte
er im Zeichen des aufkommenden Faschismus nach Bündnisgenossen. So
radikal, wie Gerhard Danzer meint, war Adlers Atheismus offenbar nicht.
Adlers Vorstellung von Religion und Religiosität war recht einseitig
und offenbar geprägt vom österreichischen Katholizismus. Neben
der natürlichen Minderwertigkeit trat seines Erachtens im Rahmen einer
religiösen Erziehung und Weltanschauung auch noch eine kulturell vermittelte
Inferiorität hinzu. Der Mensch ist ein Nichts im Vergleich zu Gott,
doch übersah Adler (genauso wie Danzer) die Stellung des Menschen
als Geschöpf Gottes und als Krone der Schöpfung, was Anlass für
ein starkes Gefühl der Überlegenheit, wenn nicht gar der Überheblichkeit
war und ist.
Wenn Adler Atheist war, dann wegen der bigotten Kleingeisterei, gegen
die schon Nietzsche rebellierte. Die Leistungen der Moraltheologie oder
die Friedensbotschaft der Bibel ignorierte Adler (und Danzer). Die religiöse
Weltanschauung ist nicht nur verwöhnend, sondern auch fordernd, in
ihren Geboten vielleicht sogar überfordernd. Andererseits kann über
die Kumpanei der Kirche mit den Autoritäten und dem autoritären
Staat kein Zweifel bestehen. Über einige quasi religiöse Einspringsel
in seiner Lehre, beispielsweise die Verheißung einer Gesellschaft,
in der Gemeinschaftsgefühl sozusagen angeboren ist, war sich Adler
durchaus nicht im klaren. Ganz sicher aber war Adler die Idee eines personifizierten,
allmächtigen Gottes völlig fremd. Statt dessen orientierte er
auf die Mitmenschen, die uns berühren und die unser Echo sind.
Bemerkenswert ist der Schlussbeitrag über „Lebenskunst", weil er
nicht so sehr darum bemüht ist, Adler oder Rattner zu referieren,
sondern in eigenen Gedanken ein Problem umkreist. Herausgeber Weier und
seine Ehefrau Bärbel Smikalla-Weier, eine Pianistin, nähern sich
einfühlsam der Kunst und ihrer Bedeutung für das Menschsein.
Kunst erschaffe eine ideale Welt mit Sinn, Schönheit, Gerechtigkeit,
Wahrheit und Freiheit. Kunst fordert zu einem weltoffenen und weltöffnenden
Dasein heraus. Lebenskunst hat demnach immer was mit Selbstschöpfung
und Selbstverwirklichung zu tun. Leben ist eine Aufgabe, die nur in wohlwollender
Verbundenheit mit den Mitmenschen zu lösen ist. Geborgenheits- und
Zugehörigkeitsgefühle sind die Früchte dieser Bemühungen.
Die Aufsätze sind durchgehend von hoher Qualität und man findet
nicht die Schwankungen in Niveau und Stil, die Sammelbände manchmal
zu einer etwas mühsamen Lektüre machen. Ein insgesamt schönes
Buch, trotz seines etwas drögen Titels und zuviel Ehrfurcht vor Adler
und der Individualpsychologie. Doch in einzelnen Passagen blitzen Gedanken
auf, die erheben und froh stimmen und die von einer tieferen Weisheit inspiriert
sind.
Jens Nauman