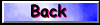Steinberger, Johann: Borderline-Kommunikation. Eine konversationsanalytische Studie. Psychosozial Verlag, Gießen 2016, 190 Seiten1
Die Borderline-Persönlichkeitsstörung stellt erhebliche Anforderungen an die BehandlerInnen. Einiges ist an Theorie zusammengetragen worden, manches verstanden, vieles noch nicht. Steinberger geht hier einen Weg über die Konversationsanalyse und versucht anhand von schriftlichen Äußerungen (Liebesbriefe an einen Praktikanten, Briefe an eine psychiatrische Abteilung) oder von Transkripten von Therapiestunden, die der Autor mit drei PatientInnen geführt hat, sowie in zwei „Experteninterviews“, die zentralen kommunikativen Elemente der Störung herauszuarbeiten.
Menschen mit Borderline Störung folgen einem manichäischen Weltbild. Die Welt ist gut oder schlecht, schwarz oder weiß. Klassisch sind drei Kognitionsschemata:
1. „Die Welt ist gefährlich und will mir nichts Gutes.“
2. „Ich bin machtlos und verwundbar.“
3. „Ich bin von Natur aus inakzeptabel“ (S. 15).
Therapeuten sind durch die Arbeit mit Borderline Patienten stark belastet, so dass sie nie zu viele von ihnen in Behandlung nehmen wollen. Die heftigen Gefühle, die die BehandlerInnen in Gesprächssituationen mit diesen Patienten erleben, können sie gut reflektieren. „Was sie aber nicht mehr wissen, sind die Gesprächsinhalte, die diesen Reaktionen vorausgingen. Die Emotionen überlagern die kognitiven Inhalte“ (S, 17).
Als zentraler Abwehrmechanismus wird allgemein die Projektive Identifizierung benannt. Damit wurde ein theoretischer Terminus gefunden, der die spezielle Interaktionsweise verständlich machen kann und Steinberger will eine Verbindung zum „typischen Sprachverhalten“ bei Borderline-Störungen herstellen.
Es lassen sich keine speziellen Gesprächsmuster abbilden, so die These des Autors, allerdings die „üblichen“ Interaktionsmuster in erhöhter Intensität. Borderline-PatientInnen „erzeugen massive Schuldgefühle im Gegenüber und bringen es in eine defensive Haltung“ (S. 20). Vergleichbare Muster werden von erfahrenen Kindergartenpädagogen beschrieben, was Daniel Stern bestätigt hat (ebd.). Solche Interaktionsmuster scheinen sich bei Borderline-Patienten erhalten zu haben. „Sie versuchen in das Gegenüber einzudringen, um negative Gefühle »abzuladen« oder um eine Verbindung zu erzeugen, die zu unterschiedlichen massiven Reaktionen führt“ (ebd.). An die Containingfunktion des therapeutischen Gegenübers werden da hohe Anforderungen gestellt.
Es folgen nun ausführlich die Klassifikationen nach DSM IV und ICD-10. Der Autor bezieht sich dann hauptsächlich auf die deskriptive Definition, wie sie von Otto Kernberg entwickelt wurde. Ferner die Symptomenliste nach einer Idee von Christa Rohde-Dachser. Dieses komplexe Symptomgefüge erschwert häufig die Diagnose. Nach Kernberg liegt die Bedeutung „in der Kombination der Symptome und der damit verbundenen Ich-Schwäche“ (S. 52).
Ausführlich stellt Steinberger die Abwehrfunktionen dar. Die Spaltung in gut und böse wird als charakteristisch hervorgehoben. Diese Abwehrfunktion ist es ja gerade, die auf Stationen ganze Teams in zwei Lager spalten kann. Diese theoretische Fassung geht auf die Objektbeziehungstheorie zurück und ich fasse es mal als kritische Anspielung gegen die ‚vernaturwissenschaftlichte‘ Sprache der Psychoanalyse auf, wenn der Autor in Klammern erläutert, dass es sich hier um zwischenmenschliche Beziehungen handelt „(Objekte = Umgang mit anderen Menschen)“ (S. 55). In der Projektiven Identifizierung wird der Feind im Außen zum inneren Verfolger
„Als Patient muss ich mich vor dem Feind (Therapeuten, Ärzten, Pflegepersonal) in Sicherheit bringen, weil das, was draußen ist, nicht wirklich von mir getrennt ist, sondern mich verfolgt und versucht, wieder in mich einzudringen“ (S.62).
Was eigentlich, wenn man mal dieses Erleben als generalisierte tatsächliche frühe Erfahrung nimmt? Wenn auch nicht alle Menschen, die eine Borderline-Störung entwickeln, sexuellen Missbrauch erfahren haben, so sind es doch wohl Grenzverletzungen unterschiedlichster Art und Weise, wozu auch physische und seelische Gewalt zu zählen sind. Was, wenn ein nicht adäquat befriedigtes frühkindliches Bedürfnis in der Interaktion aktiviert wird und aktuell nicht wahrgenommen, nicht gespiegelt, sondern als inadäquat zurückgewiesen wird? Oder wenn in Erwartung der Versagung das Gegenüber aggressiv attackiert wird, sozusagen in einer Umkehrung aus der Ohnmacht und Hilflosigkeit ein Machtgefühl erwächst, so wenigsten eine Einflussnahme möglich ist? Dass die „Guten“ letztlich auch zu den „Bösen“ werden, kann ja auch so verstanden werden, dass diese frühkindlichen Bedürfnisse im Erwachsenen unstillbar sind, zumal dann, wenn sie in der Verkleidung erwachsener verfremdeter Bedürfnisse daher kommen.
Davon erfahren wir im vorliegenden Text nichts. Vielmehr will der Autor anhand von „Datenmaterial zu erklären versuchen, wie diese Mechanismen“ aus Übertragung und Gegenübertragung „in uns ablaufen“ (S. 74). Dazu müssen wir uns ein Stück weit unter Wirkung der Spiegelneurone verstricken lassen.
Die Konversationsanalyse soll hier als methodische Herangehensweise genutzt werden. Mit ihrer Hilfe sollen die impliziten Muster, die in einem Gespräch vorherrschen, identifiziert und zu einem expliziten Wissen gemacht werden (S. 78). Mertens weist darauf hin, dass Transkripte, die nicht mit eigenen Gefühlen und Gedanken kommentiert sind eher nichtssagend sind. Und André Green hält es sogar für unmöglich, psychoanalytisches Geschehen zu beobachten, womit er sich in Gegensatz zur modernen Säuglingsforschung setze (S. 81). Aber vielleicht ist es ja mal wieder die Methode, die allein auf Empirie setzt und dem naturwissenschaftlichen Ideal folgt. Daniel Stern z.B. hat am Ende seines Forschens versucht, die empirischen Befunden phänomenologisch hermeneutisch in eingefühltes Erleben umzusetzen. Er weiß natürlich nicht, ob das „Tagebuch eines Säuglings“ (1990) dessen vorsprachliches Erleben wirklich abbildet. Aber es zeugt von einem beachtlichen Einfühlungsvermögen unter Nutzung empirisch gewonnenen Wissens. Und Steinberger beruft sich denn auch auf Stern und das „implizite Beziehungswissen“, das den quantitativen Methoden erhebliche Hürden in den Weg stelle.
„Psychotherapeuten intervenieren nicht, wie es viele ihrer Vertreter [quantifizierender Methoden, BK] gerne sehen würden, auf der Basis einer »richtigen« Theorie, sondern die Theorie erschließt sich in Reflexion der vorangegangenen Interaktion. Alles andere wäre eine Simplifizierung und »Medizinisierung«, wie sie von Vertretern der Krankenkassen gerne gesehen würde“ (S. 82).
Die Kompetenzen psychotherapeutischer Behandlung liegen gerade in der Bereitschaft, „dem Unerwarteten zu begegnen“ (ebd.) und nicht in der Anwendung von Theorien und Manualen.
Soweit der Anspruch. Wenn der Ansatz des Autors auch verdienstvoll ist, so kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass dann doch theorieimmanent vorgegangen wird. Es ist auf jeden Fall mutig, zumal in Hinsicht auf die eigenen Therapiegespräche des Autors, sie der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Meine Kritik möchte ich denn auch nur als Veränderung der Perspektive verstanden wissen. Psychotherapie ist so komplex, dass sich in jeder Behandlungsstunde „Mängel“ aufweisen lassen, denn die „Now-Moments“ (Stern) sind nicht unser täglich Brot, sondern doch eher die Sternstunden im doppelten Wortsinne.
Mir scheint denn also, dass der Autor doch zu sehr die Inhalte betrachtet und zu wenig zwischen den Zeilen liest. Dazu gehört auch, dass die Kurzbiographien von einer derartigen Kürze sind, dass ich als Leser überhaupt keine Vorstellung vom „In-der-Welt-Sein“ der PatientInnen bekomme. Darüber hinaus werden die Gesichtspunkte einer relationalen Psychoanalyse zu wenig beachtet, d.h. die Co-Kreation des dialogischen Geschehens.
Exemplarisch scheint mir dies im Interview mit W.A. sehr deutlich. Es kommt das Gespräch auf seine Sexualität, die er fast nicht leben kann, zumal offenbar seine Bedürfnisse nicht mit denen seiner Frau übereinstimmen. Ich möchte die Passage mit Kommentar ausführlich zitieren.
Unter dem Obertitel, „Eindringen in die Persönlichkeit des Therapeuten“ wird folgende Sequenz herausgegriffen
„Im dritten Beispiel sehen wir die Wünsche sehr konkret und bar jeder Verkleidung. Der Patient fordert sein Bedürfnis stark auf der Handlungsebene ein.
Aus dem Interview W.A. lässt sich folgende Passage für diesen Sachverhalt heranziehen:
K: Ja Ja, ich bin nämlich der Spritzer. Spritzig. Abspritzen ist schön, hab‘ ich schon länger nicht gemacht. Sie versteh‘n, was ich meine?
Th: Das Thema hat sie ja schon einmal beschäftigt, dass Sie keine Sexualität leben.
K: Ja. Ich lebe sehr wohl Sexualität, aber nicht bis zum Orgasmus. Geb'n Sie mir die Hände, die Hände, bitte, nur die Hände hinlegen. Ja. Berühr‘n Sie mich mit einer Hand. Nur die Fingerspitzen.
Hier ist der Versuch des Therapeuten, die vorherrschenden Gefühle zu abstrahieren bzw. zu mentalisieren, um von der Handlungsebene wegzukommen, da es ja auch um die unbewussten homosexuellen Anteile des Behandlers geht. Dieser Versuch ist vermutlich durch die Angst des Therapeuten hervorgerufen, der entsprechend die Emotionen herunterregulieren möchte“ (113).
Dies scheint mir typisch für das Theorie geleitete Missverständnis. Diese Sequenz ließe sich auch anders verstehen: Der Patient ist anscheinend mit einem Bedürfnis nach Nähe in Kontakt und weiß es nur in sexualisierter Form auszudrücken. Das erinnert an Ferenczis „Sprachverwirrung zwischen den Erwachsenen und dem Kind“ (1933). Das Kind hat ein Bedürfnis nach Zärtlichkeit und der Erwachsene interpretiert es als sexuelle Verführung. Und warum muss der Therapeut unbedingt von der Handlungsebene weg? In einer leibfundierten Psychoanalyse (Geißler, Heisterkamp 2013) würde man dies gerade aufgreifen und so dem Patienten die Möglichkeit eröffnen, mit dem basalen Gefühl einer Sehnsucht nach Zärtlichkeit bzw. Kontakt in Berührung zu kommen. Der Patient ist sogar bereit, sein Bedürfnis zu minimalisieren als der die Zurückhaltung des Therapeuten bemerkt. Er wäre schon mit einer Berührung an den Fingerspitzen zufrieden – Hauptsache ein bisschen Kontakt. Die „homosexuellen“ Anteile des Therapeuten stellen wieder eine Theorie geleitete Annahme dar, es sei denn, der Therapeut spricht aus seinem Erleben. Zunächst einmal würde ich annehmen, dass er überhaupt Berührungsängste hat, weil er – wieder Theorie geleitet – Angst vor dem Verlust der Abstinenz hat. Abstinenz ist jedoch eine innere Haltung, die aus der Reife derie AnalytikerIn erwächst und daraus, dien PatientenIn nicht zu be-nötigen (Geißler/Heisterkamp 2007), sondern zu helfen, das Un-Sagbare und Un-Fassbare in den Dialog zu holen (Poettgen-Havekost 2016). Außerdem hätte er zunächst einmal über das Bedürfnis des Patienten reden können, sich im phantasmatischen Raum diesem Bedürfnis annähern können ohne in die Handlung zu gehen.
Schon vorher in der Stunde geht es immer um ein Kontaktbedürfnis, das immer wieder zurückgewiesen wird. Da geht es um die Aufnahme der Stunde mit dem Mikrophon. Es ist ihm offenbar wichtig, gehört, aufgenommen zu werden (S. 176). Dann hat er ein Handy dabei, ein Klapphandy. „Da kann ma mit‘n Ohr zu Ohr und mit‘n Mikro zum Mund. Da braucht ma nicht so blöd redn“ (S. 178). Welche Metapher für Kommunikation! Und nach weiterem Geplänkel übers Handy will er die Stunde beenden. Nachdem der Therapeut ihn an die Vereinbarung erinnert hat, geht es weiter um das Honorar des Therapeuten und hin und her wegen des nächsten Termins. Schließlich fragt er den Therapeuten: „Was krieg‘ i für ein Honorar?“ (S. 179). Es scheint so, dass der Patient findet, dass er, nicht der Therapeut ein Honorar bekommen müsste, da dessen Interventionen nicht als hilfreich erlebt werden. Der Patient wird dann auch unterschwellig aggressiv, würde gerne ein Glas Wasser über den Therapeuten schütten. Das wird aber alles nicht wirklich aufgegriffen und der Patient hält dem Therapeuten dann den Spiegel vor: „Sag‘n Sie nicht immer ja wie ein kleiner Bub, dem man was Neues erzählt, das er nicht versteht“ (S.180). Hier wieder ein Angebot, wirklich in Kontakt zu kommen, in einen echten Dialog. Indes der Therapeut sich nur verteidigt, kein kleiner Bub zu sein. Weiter ein Gedankenspiel, auch das ein Kontaktangebot, das nur oberflächlich an Wirrheit zunimmt. Der Therapeut bleibt einsilbig: „Mmmh“. Nun bringt Herr A. das Theorem der Spiegelung auf die Bühne. Der Therapeut reagiert mit einer Deutung und der Patient bietet ihm an, dass er doch derjenige sei, der ihn spiegele. Wieder eine verpasste Chance. Nachdem es jetzt um Äußerlichkeiten geht, um Titel, verpasst Herr A. dem Therapeuten aggressiv ironisch einen Titel: „Diplomgesundheitskrankenpfleger Psychotherapeut Therapiezentrum. Sie haben ein Propädeutikum gemacht oder noch nicht“ (S. 183). Die Ironie wird nicht wahrgenommen, stattdessen „bestätigt“ der Therapeut ohne Authentizität: „Sie kennen sich ganz gut aus in der Ausbildung“ (ebd,). Der durchaus intelligente Patient dürfte sich hier schon wieder nicht wahrgenommen fühlen. Der Patient strengt sich wirklich an, hätte gerne, dass der Therapeut mit ihm lacht: „Ja natürlich [möchte er, dass der Therapeut mit ihm lacht, BK], ich find‘ das lustig, was ich mach‘. Ich reiß‘ doch den dummen August runter“ (ebd.). Und weiter wieder im Geplänkel. Der Patient konfrontiert den erlebten Mangel: „Sie antworten mit Ja oder Nein. Das find‘ ich ganz brav von Ihnen und lassen nur mich reden. Wolln Sie nicht auch ein bissel sprechen? Bitte um eine Wortspende“ (S.184). Der Therapeut wiederholt: „Sie möchten eine Wortspende?“ Und erhält explizit vorgesagt, was der Patient braucht: „Von Ihnen ja. Wie empfinden Sie die Situation jetzt? Lustig, bedrückend, blöd? Therapeutisch? Untherapeutisch? Geht es in eine gute Richtung, geht es in eine schlechte Richtung? Bitte um ein Referat von mindestens einer Minute“ (ebd.). Nachdem der Therapeut nun mal etwas mehr gesprochen hat, kommentiert Herr A.: „Spenden Sie weiter“. Es kommt jedoch keine Verständigung zustande. Und erst jetzt kommt die drastisch vorgetragene Sexualität und explizit das Berührungsbedürfnis. Das Verstehen gelingt nicht, der Patient gähnt demonstrativ. Und wie beim Säugling in der Interaktion mit einer depressiven Mutter gibt Herr A. nicht auf: „Warum schweigen Sie so frech?“ Und auf die Klage des Patienten, dass alles so mühsam ist, er nicht in Kontakt kommt, fragt ihn der Therapeut, was ihn so unzufrieden macht. Und tatsächlich erhält er die Antwort: „Ich will Nähe, ich will Zärtlichkeit“. Noch ein weiterer Versuch und dann gibt Herr A. auf, externalisiert seine Wut und Verzweiflung, indem er einen Mitpatienten vor der Tür des Behandlungsraumes verbal attackiert, von dem er annimmt, dass er zuhört. Der soll nicht zuhören, aber sein Therapeut! Und vor allem soll er antworten. A.R. Bodenheimer (1987) brachte es auf den Punkt: „Verstehen heißt antworten“. Herr A. externalisiert seine Wut möglicherweise, nutzt also die Projektive Identifizierung, um die Beziehung zum Therapeuten nicht zu gefährden, hofft auf Verständigung, hat noch nicht völlig resigniert.
Da wir wesentlich aus dem Misslingen lernen, ist der vorliegende Text auch in dieser Hinsicht sehr zu empfehlen.
Literatur:
Ferenczi, Sàndor (1933): Sprachverwirrung zwischen den Erwachsenen und dem Kind in: Ferenczi, Sándor: Schriften zur Psychoanalyse II, S. 303 - 313),S. Fischer Verlag Frankfurt am Main 1972
Geißler, Peter/Heisterkamp, Günter (Hg) (2007): psychoanalyse der lebensbewegungen. zum körperlichen geschehen in der psychoanalytischen therapie. ein lehrbuch. Springer, Wien/NewYork.
Geißler, Peter/Heisterkamp, Günter (2013): Einführung in die analytische Körperpsychotherapie. Psychosozial Verlag, Gießen.
Poettgen-Havekost, Gabriele (2016): Köpersprachen – Die Einbeziehung des körperlich-seelischen Ausdrucksgeschehens in die analytische Psychotherapie, in: Walz-Pawlita, Susanne/Unruh, Beate/Janta, Bernhard (Hg) (2016): Körper-Sprachen. Psychosoazial Verlag, Gießen.
Stern, Daniel (1990): Tagebuch eines Säuglings. Was ein Kind sieht, spürt, fühlt und denkt. 2. Auflage 1991, Piper Verlag, München.
1Erstveröffentlichung in der Zeitschrift für Individualpsychologie 3/2017.
Bernd Kuck 
November
2016
-
|
direkt bestellen:
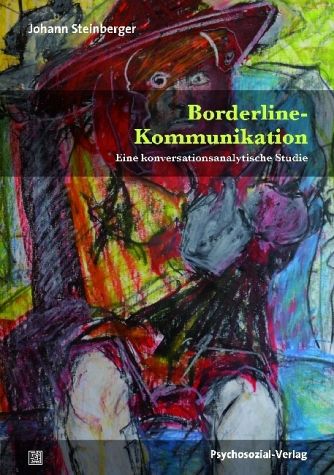
Borderline-Kommunikation
|
Oder in der nächstgelegenen
Buchhandlung! So landen die Steuereinnahmen zumindest in
"unserem" Steuersäckel, was theoretisch eine
Investition in Bildung und Erziehung ermöglichen würde.
In Bonn-Bad Godesberg z.B. in der
Parkbuchhandlung

|