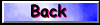Spitzer, Manfred: Vom
Sinn des Lebens. Wege statt Werke, Schattauer Verlag, Stuttgart
2007, 224 Seiten
Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer studierte Medizin, Psychologie und
Philosophie in Freiburg, war Oberarzt an der Psychiatrischen
Universitätsklinik in Heidelberg, Gastprofessor in den USA .
Seit 1997 hat er einen Lehrstuhl für Psychiatrie in Ulm. Als
Mitherausgeber der Zeitschrift "Nervenheilkunde"
veröffentlicht er selbst regelmäßig
Forschungsergebnisse aus den Neurowissenschaften, die schon
verschiedentlich in Buchform zusammengefasst verlegt wurden (z.B.
„Nervensachen“). Auch
der vorliegende Band ist eine solche Zusammenstellung, die wiederum
den souveränen Stil des Autors bekundet. Er schreibt nicht nur
für Fachkollegen, sondern möchte ganz offenbar einen
Beitrag zur Allgemeinbildung leisten, weshalb er ja wohl auch eine
Fernsehserie zum Thema Geist und Gehirn moderiert.
Wie kurzweilig kann doch Wissenschaft sein! Komplexe Themen
werden faßlich dargestellt, ohne dabei je den
wissenschaftlichen Boden zu verlieren.
Der Titel des Buches ist
allerdings etwas irreführend. Einzig die Einleitung und ein
kritischer Aufsatz „Neurotheologie“ versuchen bei der
Frage nach dem Sinn, einen zwischen den Wissenschaften vermittelnden
Standpunkt einzunehmen. Die Welt lässt sich nicht in Schubladen
einteilen ohne von den anderen Schubladen Notiz zu nehmen. Sie
offenbart sich als äußerst komplex, so dass es wohl kaum
nur einen Sinn geben wird.
„Jeder
kommt mit ganz bestimmten Eigenschaften auf die Welt und kultiviert
diese, wenn es gut geht, im Laufe seines gesamten Lebens. Wenn es
klappt, stimmen die Umstände, man trifft die richtigen Menschen,
und angeborene sowie vorgefundene Strukturen passen aufeinander. Dann
entsteht nicht nur Sinn, sondern sogar Glück!“ (19)
Dass ist ungefähr die lang
bekannte 'Drittelstheorie', wonach ein Drittel Konstitution, ein
Drittel soziale/kulturelle Umwelt die Formung des Menschen ausmachen.
Das letzte Drittel, „was einer daraus macht“, formuliert
Spitzer nicht so pointiert, wie etwa Alfred Adler, denn irgendwie
scheint ihm das Schöpferische ein wenig auf schwankendem Boden
angesiedelt, weshalb er sich lieber an die „Tatsachen“
halten möchte. Das hindert ihn aber nicht daran, die anderen
Phänomene gelten zu lassen, solange sie den Tatsachen nicht
widersprechen. So müssen „Natur- und
Geisteswissenschaften, Wissenschaft und Politik, Fakten und Werte“
( 2) in einen gegenseitig befruchtenden Austausch treten. Spitzer
fasst sein ethisches Credo in drei Sätzen zusammen, die an
Sokrates, Kant und Schopenhauer erinnern:
„Werde nicht nur, der Du
bist, sondern
erkenne Dich selbst und
hilf den anderen!“ (19)
Der Austausch zwischen den
Disziplinen ist gerade bei den Untersuchungen der Neurowissenschaften
– und vor allem wegen der sich auf sie berufenden oder aus
ihnen abgeleiteten Interpretationen – notwendiger denn je.
Trotz der naturwissenschaftlichen Untersuchungsergebnisse bedürfen
diese eben der Interpretation. Und da erst findet die fruchtbare
Auseinandersetzung statt. Zunächst sagen sie nämlich nur,
dass alle Äußerungen des Menschen, die wir
seelisch-geistig nennen, eine körperliche Basis haben. Und
sie sagen aus, dass im statistischen Mittel, in dem bekanntlich alle
„Ausreißer“ eliminiert werden oder untergehen, der
Mensch auch nur Lebewesen dieser Erde ist. Nach wie vor sind die
Experimente z.B. zur Willensthematik ziemlich simpel ja fast
„geistlos“, sagen im Grunde nichts über werthaltige
Willensregungen aus, die den Menschen erst zu bedeutsamen Leistungen
befähigen, wenngleich ihm letztlich immer irdische Grenzen
gesetzt sind. Selbst in einem Experiment zur „Willenskraft“
(i.e. Durchhaltevermögen), in dem es um einen Vortrag über
Studiengebühren ging, nivelliert die Statistik die Komplexität
des Einzelfalles. Zwar versuchte man die Stimmung der Probanden
via Fragebogen zu erfassen. Die charakterliche Grundhaltung und
Wertorientierung blieben unberücksichtigt. Wirkliches
Verstehen von Individuen findet eben jenseits der Statistik statt und
das wird wohl noch lange so bleiben.
Selbst wenn Spitzer durchaus dafür ist, dem Unbewußten
(welches schon aufgrund der Tatsache, dass es in kurzer Zeit vielmehr
Informationen verarbeiten kann als das Bewußtsein, wesentlich
effektiver die Lebensfähigkeit des einzelnen garantiert)
die Führung wie einem Autopiloten zu überlassen (S. 28ff),
sieht er die Notwendigkeit des bewußten Eingreifens und
Umlernens gegeben, wenn es Probleme gibt. So wäre auch Freud zu
verstehen, der sich ja immerhin mit krankheitswertigen Symptomen
befasste. Um hier einzugreifen ist es schon sinnvoll und notwendig,
unbewußte Strukturen bewußt zu machen. Der Terminus
'krankheitswertig' bringt bereits die Wertorientierung auf den Plan:
Es ist durchaus ein „glücklicher“ Massenmensch
vorstellbar, der unbewußt, ja mancher würde sagen: dumpf,
dahinlebt. Unter dem Wertgesichtspunkt kann dies jedoch ein
fragliches Leben sein.
Eher kurios sind die statistischen Ergebnisse, wonach der Name
die Berufswahl und den Wohnort unbewußt beeinflussen
sollen. So sei z.B. die Wahrscheinlichkeit, dass Jo Rock in Little
Rock wohnt, um 38 % erhöht.
Interessant hingegen – und für die Zukunft für
Schmerzpatienten hoffnungsvoll – sind die Untersuchungen
zum Neurofeedback, einer Variante des Biofeedback. In ihnen konnte
gezeigt werden, dass der Beeinflussungseffekt der Schmerzen über
Neurofeedback deutlich größer ist – nämlich ca.
ein Drittel – als beim üblichen Biofeedback. Man macht
sich dabei die Möglichkeit der visuellen Darstellung der
Magnetresonanz-Signale des Gyrus cinguli zu nutze, die man den
Probanden mit wenigen Sekunden Verzögerung (z.B. mit Hilfe einer
Videobrille) präsentiert. Nach nur drei Trainingssitzungen
lernten die Versuchspersonen, die Erlebnisqualität ihrer
Schmerzen deutlich abzuschwächen. Über die
Langzeitwirkung weiß man noch recht wenig, darf aber gespannt
auf weitere Ergebnisse sein.
Ebenfalls in den Kinderschuhen stecken Untersuchungen zur
Verbesserung des Lerneffekts bei psychotherapeutischen
Interventionen. So konnte – wenn auch in einer recht kleinen
Studie mit 27 Teilnehmern – der positive Effekt einer
Verhaltenstherapie bei Höhenangst durch die Gabe von
D-Cycloserin (eigentlich wird es als Antibiotikum in der
Tuberkulosetherapie eingesetzt) wesentlich gesteigert werden. Vor
allem war der angst reduzierende Effekt noch drei Monate nach der
Behandlung stabil, was mit bloßer VT nicht erreicht werden
konnte. Interessant ist die Studie, weil sie als Doppelblindstudie
durchgeführt wurde. Spannend dabei, das D-Cycloserin sich nicht
angst mindernd vor der Psychotherapie auswirkte, also kein
Anxiolytikum ist. Sollten die Befunde sich erhärten lassen,
könnten Psychotherapien mit pharmakologischer Unterstützung
wesentlich verkürzt werden. Aber vielleicht ist die Donau
schon versiegt, ehe solche Effekte auch bei komplexen
Persönlichkeitsstörungen zu erzielen sind. Und ob eine
der nächsten Pisa-Studien schon besser ausfallen wird, wenn
vor der Mathematikstunde D-Cycloserin eingenommen wird, bleibt ebenso
abzuwarten. Mir will nur scheinen, dass die Komplexität der
Lernfaktoren immer noch weit unterschätzt wird. Die besten
Erfolge wurden immerhin bei Ratten erzielt.
Lange schon ist
bekannt, dass aggressive Männer einen höheren
Testosteronspiegel aufweisen. Inzwischen gibt es aber auch eine
Studie, die zeigt, dass die Beschäftigung mit einer Waffe den
Testosteronspiegel ansteigen lässt (zumindest bei Männern,
Frauen wurden nicht untersucht). Und eine Untersuchung befasst sich
mit der Auswirkung beobachteter positiver Handlungen, die Gefühle
der Dankbarkeit oder Erhabenheit bewirken. Stillende Mütter (an
dieser Studie waren keine Männer beteiligt), die Videos solchen
Inhaltes anschauten, zeigten entweder Milchfluss oder stillten die
Säuglinge nach dem Video (fast die Hälfte der Mütter!).
Solches taten nur wenige der Mütter, denen Videos mit
Komödianten und deren Späßchen gezeigt wurden.
Solcher Art Untersuchungen bräuchten wir noch mehrere,
zeigen sie doch, dass wir nicht nur Spielball der Hormone sind,
sondern dass werthaltige soziale Bezüge ebenso wie wertwidrige
Einfluss auf unsere Hormonausschüttung nehmen.
Ästhetik
im Tanz ist nicht nur schön anzusehen, sondern erhöht auch
die Attraktivität des Tänzers. Die reproduktive
Fitness hat bereits Darwin in der Ausdrucksmöglichkeit des
Tanzes gesehen. Wichtig dabei ist, dass die Symmetrie der
körperlichen Erscheinung einen Hinweis auf die Gesundheit
des Tänzers gibt, da paarige Organe meist nicht gleichermaßen
von Krankheitserregern befallen werden. Dies lässt sich in einem
experimentellen Konstrukt nachweisen. Ob die evolutionsbiologischen
Schlussfolgerungen dann letztlich doch nur für die weniger
gesprächsfähigen Schuhplattler in höheren
Alpenregionen zutreffen, bleibt der wertphilosophischen Position des
Betrachters überlassen.
Spannend
sind die Ergebnisse hinsichtlich der Darbietung von
Entscheidungskriterien. Muss der Mensch etwa zwischen einer Operation
oder Bestrahlung wählen, so ist es von Wichtigkeit, ob dem
Probanden die Erfolgsquote als mit 68% Überlebensrate oder 32%
Todesrate offeriert wird. In der ersten Darstellungsart entscheiden
sich die meisten für die Operation. In einem anderen
Experiment, in dem es um Geldgewinn oder -verlust ging, zeigte
die Analyse der fMRT-Daten (funktionelle Magnetresonanztomographie)
eine Aktivität der Amygdala, wenn die Probanden sich für
einen sicheren Gewinn bzw. für die Wette bei drohendem Verlust
entschieden. Ohne Aktivität blieb die Amygdala, wenn sich die
Probanden für eine Gewinn-Wette oder einen sicheren Verlust
entschieden. Die Daten werden dahingehend interpretiert, dass
die Amygdalaaktivität ein emotionales Signal existenzieller
Qualität repräsentiert, das die Probanden den sicheren
Gewinn akzeptieren lässt, bei drohendem Verlust ihre Chancen
durch wetten zu verbessern suchen.
Dies macht die Abhängigkeit
unserer Entscheidung von dem Formulierungsrahmen (Gewinn oder
Verlust), dem „Framing-Effekt“, verständlich. Bei
einzelnen Probanden trifft es jedoch nicht so ohne weiteres zu. Je
aktiver nämlich der mediale orbitofrontale Kortex war (hier wird
die Rationalität angesiedelt), je rationaler also ein
Mensch sich generell verhält, desto weniger unterlag er dem
Framing-Effekt, hatte er folglich seine Emotionen besser im
Griff. Der Vorschlag Spitzers, Politiker vor ihrer Wahl auf die
Aktivität ihres orbitalen Kortex zu scannen, hat etwas für
sich. Ein Test auf ihr humanistisches Potential und ihre emotionale
Intelligenz sollte dabei nicht vergessen werden.
Wieso
nehmen eigentlich so viele Menschen an Glücksspielen teil,
speziell am Lotto? Was Dostojewskij zu diesem Thema zu sagen
hatte („Der Spieler“), würde Spitzer sicher nicht
ignorieren. Aber wieso spielen Menschen z.B. einen Dauerlottoschein,
den sie ausfüllen, abgeben und dann zu hause sitzen, also etwa
den Kick mit anderen am Roulettetisch zu sitzen, gar nicht haben?
Nun, sie sitzen halt vor dem Fernseher und spannen auf die Ziehung am
Samstag. Und neurobiologisch? Man hat herausgefunden, dass
Dopamin-Neuronen nicht nur auf Belohnung reagieren, sondern dass es
während des Zeitraumes zwischen Reiz und Belohnung eine Zunahme
ihrer Aktivität gibt. Diese Reaktion war am größten,
wenn die Wahrscheinlichkeit 0,5 betrug, also bei größter
Unsicherheit ob des Erfolges. Nun ist Dopamin allgemein an
Aufmerksamkeitsprozessen beteiligt. Ist die Aufmerksamkeit
unspezifisch, wird am besten gelernt. Dies wird nun wiederum mit
einer Neugierhaltung assoziiert. Und damit sind wir wieder bei
dem evolutionsbiologischen Vorteil des ganzen Geschehens. Wer nämlich
neugierig ist, der hat die größten Chancen, etwas Neues zu
lernen, was ihm einen Vorteil bei der Überlebensfähigkeit
verschafft. Und das Lotto? Eigentlich weiß jeder, dass
letztlich immer drauf gezahlt wird, denn sonst könnten
Lotterien pleite gehen, was noch nie vorgekommen ist. Die Leute
spielen also Lotto, so die Hypothese, weil sie damit Unsicherheit
einkaufen und so zu einer lustvollen Dopaminausschüttung
kommen. Normalerweise – sieht man vom süchtigen Spieler ab
– kommt man so nicht in existenzielle Notlagen, sondern hat ein
vollkommen kalkulierbares Risiko. Der Mandelkern kann demnach
ganz ruhig bleiben, der Dauerlottoscheinkäufer erlebt also keine
Angst, anders als der Extremkletterer. Für Sparsame hat Spitzer
einen Tipp bereit:
„...dass
Neugierde billiger ist, die gleiche Auswirkung auf das Dopaminsystem
hat (macht Spaß) und drittens auch noch zum Lernen führt.
Wenn das kein Grund ist, neugierig zu sein.“ (147f)
Bei
den Schweinsaffen führt die Anwesenheit von starken Männchen
zu weniger gefährlichen Konflikten in der Affengesellschaft und
zu mehr sozialem Verhalten. Männer in der menschlichen
Gesellschaft empfinden weniger Mitgefühl als Frauen mit einem
anderen Menschen, wenn dieser vorher als unfairer Zeitgenosse erlebt
wurde. Dies wurde anhand der Aktivität des fronto-insularen
Kortex bei Männern und Frauen dargestellt. Fairness wäre
damit als wesentlicher Faktor für die Entstehung und
Aufrechterhaltung größerer sozialer Verbände
identifiziert. Dass die Präsenz von Polizisten „indirekt“
bewirkt, „dass wir Freunde und Helfer“ (169) haben, hat
ja was. Aber ist die ganze Untersuchung nicht lediglich ein Beleg
dafür, dass wir es gegenüber den Affen noch nicht so arg
weit gebracht haben? Und immer wieder stellt sich die Frage nach
Henne oder Ei. Gibt es nun entsprechende Hirnaktivitäten, weil
der männliche Mensch in unserer Kultur eben Rachegefühle
hat oder hat er Rachegefühle aufgrund der Aktivität
entsprechender Hirnareale?
Überraschend
ist das Untersuchungsergebnis, wonach die erlebte Schmerzerfahrung,
z.B. einer Darmuntersuchung, im Nachhinein nicht von der Dauer des
Schmerzerlebens, sondern von dem Mittelwert aus stärkstem
Schmerz und Schmerzen am Ende der Prozedur („peak-end-rule“)
beurteilt wird. Dies gilt im Übrigen auch für positive
Erlebnisse, wodurch die Regel der Großmütter, aufzuhören,
wenn es am schönsten ist, eine experimentelle Verifikation
erfuhr. Dies gilt auch für die Einschätzung des
gesamten Lebens – zumindest von normal neurotischen Studenten.
Die beurteilten nämlich die Zufriedenheit mit ihrem Leben
signifikant besser, wenn sie vor der Befragung in einem öffentlichen
Telefon ein zehn Cent Stück fanden.
Dass
Hilfsbereitschaft und Kooperation wesentliche Merkmale nicht nur
menschlicher Gemeinschaften sind, konnte bereits Kropotkin
zeigen („Gegenseitige Hilfe in der Entwicklung“). Dass es
sich für den Menschen nicht nur um eine kulturelle Leistung
handelt, wurde nun vom Max-Planck-Institut für evolutionäre
Anthropologie in Leipzig auch für Affen gezeigt. Vor allem aber,
dass sie, wie der Mensch, Kooperationspartner wählen, bevorzugt
jemanden, der auch wirklich etwas kann, um das Ziel zu erreichen.
Also nicht einfach nur sozial, sondern „clever-sozial“.
(176)
Das Affenexperiment, bei dem die Tiere zunächst
lernten, eine Tür zu öffnen, bestand darin, ein Tablett
mit leckerem Futter heranzuziehen. Allerdings verlief das Seil so
durch zwei Ösen des futtertragenden Brettes, dass dessen Enden
zu weit auseinander lagen, als das ein Affe allein das Brett hätte
zu sich ziehen können. Zog er folglich an einem Seilende, hatte
er zwar ein Seil, das Futter war aber keinen Millimeter näher
gerückt. Wenn er nun die Tür zum Nachbarkäfig öffnen
würde, könnte der Nachbar zu ihm kommen und damit sie
gemeinsam an die Leckereien, indem sie kooperativ jeder an einem
Seilende zogen. Das geschah auch in 73,4 % der Fälle. Wurde das
Arrangement nun dahingehend verändert, dass der Affe auch allein
an die Leckereien kam (die Seilenden lagen dicht genug
beieinander), baten immerhin 30,4% den Nachbarn hinzu um gemeinsam zu
futterten. Hier beginnt die wirklich kulturelle Leistung, durch
ethische Überlegungen den Prozentsatz zu erhöhen, was
bislang dem Menschen vorbehalten bleibt – als
Potenzialität!
Bei der Frage, ob auch Affen „genetisch“
zu Hilfsbereitschaft neigen, wird es dann unscharf. In einem
Experiment konnte gezeigt werden, dass Kleinkinder einem Erwachsenen
durchaus behilflich sind, wenn er mimisch seine Hilfsbedürftigkeit
kenntlich macht. Affen würden dies auch tun – allerdings:
die Affen, die am Experiment teilnahmen, lebten unter Menschen und
waren von diesen erzogen worden.
Spitzer
war auch auf einem Psychiaterkongress in Swasiland. Er berichtet u.a.
von den desolaten Zuständen in diesem Land, der gewaltigen Kluft
zwischen reicher Klasse und Armen. Swasiland ist das einzige
Königreich auf dem afrikanischen Kontinent und zugleich das
kleinste Land. Die ungeheure Aids-Rate hindert den König
nicht an einem größenwahnsinnigen Lebenswandel. Die
durchschnittliche Lebenserwartung liegt bei 36,5 Jahren.
Man
kommt nicht an der Tatsache vorbei, dass weltweit etwa 84% der
Menschen religiös sind. Ob nun aktiv oder passiv sei
dahingestellt.
Nach
einer im Time-Magazin veröffentlichten Gallup-Umfrage glauben
96% der US-Amerikaner an Gott, 90% an den Himmel, 79% an Wunder, 73%
an die Hölle, 72% an Engel und 65% an die Realität des
Teufels.“ (208)
Die
Frauen ein bisschen mehr als die Männer. Die Bildung spielte
nicht eine so große Rolle. An den Himmel glauben immer noch 75%
der Uni-Absolventen, 80% der College-Absolventen und 90% derer, die
irgendwann mal ein College besucht haben. 94% glauben an den Himmel
und haben keine College-Ausbildung. Immerhin!
Immer noch 40% der
amerikanischen Wissenschaftler glauben an Gott und der bekannteste
Genetiker, Francis Collins, hat gerade ein Buch – The
Language of God – veröffentlicht, in dem er die Kluft
zwischen Wissenschaft und Religion überbrücken will.
In
Deutschland glauben immer noch 32% an Engel, wenn auch von den 53
Millionen Christen nur ein paar Prozent sonntags in die Kirche
gehen.
Da nach einer Definition meiner Religionslehrerin Glaube
dort anfängt, wo der Verstand aufhört, wundert es
nicht, dass die meisten Katholiken nicht wissen, dass sie via Dogma
an die leibhaftige Auferstehung Jesu und die leibhaftige
Himmelfahrt der Mutter Gottes, Maria, glauben, dies allerdings erst,
seit sich der Papst 1950 dazu entschieden hat.
Welche Türkinnen
wissen schon, dass im Koran von einem Kopftuch nichts steht und
selbiges erst seit den 70-iger Jahren zu einem religiösen
Statussymbol mutierte. Im Übrigen tragen in Ulm mehr türkische
Frauen das Kopftuch als in Izmir, der zweitgrößten Stadt
der Türkei.
Seit
langem ist bekannt, dass Patienten mit Anfallsleiden zu starken
religiösen Erlebnissen neigen (Temporallappenepilepsien).
Manche schlossen daraus, dass der Sitz religiöser Erlebnisse der
Temporallappen sei. Da Hildegard von Bingen vermutlich nicht so sehr
vom Heiligen Geist, sondern von ihren Migräneanfällen
inspiriert war und Saulus vermutlich aufgrund einer dissoziativen
Störung zu einem Paulus wurde, scheint die religiöse Basis
nicht allein auf einen Teil des Gehirns beschränkt.
Dass
während der Meditation bei einigen das Raumgefühl abhanden
kommt, hängt zunächst einmal damit zusammen, dass im
Scanner (fMRT) nachgewiesen werden konnte, dass die Aktivität
des Parietalhirns abnahm, welches für die räumliche
Orientierung des Organismus zuständig ist.
Wer
sich also beim Meditieren „im Nichts“ fühlt, der
fühlt schlicht die Abschaltung seines Zentrums für die
eigene Verortung.“ (210)
Wird
mit Inbrunst Psalm 23 im Scanner gebetet, so zeigt sich zum Leitwesen
der Gläubigen, dass die emotionalen Areale weniger beteiligt
sind als die kognitiven. Denkt der Mensch jedoch im Scanner über
moralische Themen nach, die ihn selbst betreffen, so werden die
Bereiche des Gehirns aktiviert, die auch durch affektive Prozesse
aktiviert werden. Daraus folgt, dass die emotionale Beteiligung bei
Wertentscheidungen größer ist, als manch einem lieb sein
könnte. Dies ließe sich demnach als eine Bestätigung
der Thesen von Max Scheler lesen, wonach Gefühl Werterkenntnis
sei.
Für die Existenz Gottes folgt daraus erst einmal gar
nichts. Es wird heute kaum mehr behauptet (wie seinerzeit vom
radikalen Solipsismus oder heute vom radikalen Konstruktivismus),
dass es den blauen Himmel nur in unseren Köpfen gibt, der über
das Sehzentrum zu Aktivitäten im Gehirn führt, und uns
einen Himmel konstruiert.
Man
darf also auch in der Gehirnforschung das Erklären nicht mit dem
Hinwegerklären verwechseln. Wenn man weiß, welches
Areal beim Betrachten oder beim Riechen einer Rose, beim Hören
von Musik oder beim Küssen aktiv ist, folgt daraus, dass es
keine Rosen, keine Musik oder keinen Kuss gibt? - Gewiss nicht! Es
folgt nur, dass es keine Erfahrung gibt, die nicht in unserem Gehirn
stattfindet und entsprechend mit bestimmten Vorgängen im
Gehirn einhergeht.“ (211)
In
der Weise, wie das Sehsystem im Gehirn lokalisiert ist, das uns mit
Empfindungen von Farben und Formen (also auch mit der
Wahrnehmung des blauen Himmels) versorgt, ist jedes Erleben,
Empfinden, Wahrnehmen und Denken irgendwo im Gehirn lokalisiert.
Damit ist Religiosität ebenso „im Gehirn“ wie
Musikalität, Sprachlichkeit, Witz, Tapferkeit,
Extraversion, Intelligenz oder was es noch an höheren geistigen
Leistungen und Dimensionen zu deren Beschreibung geben mag.“
(212)
Ob
nun aber die Religion durch die Neurowissenschaft neu belebt werden
sollte, statt der esoterischen- oder Pop-Gläubigkeit, sei
einmal dahingestellt. Da wäre mir schon die Etablierung eines
philosophischen Weltbildes, dass die Rückbezüglichkeit,
die Bindung des Menschen an Mensch und Welt fundierte, lieber. Aber
immer noch besser, als die Wissenschaftsfeindlichkeit, wie sie sich
in der Debatte um die Evolutionstheorie in Amerika gebärdet.
Bonn, April 2007
Bernd Kuck 
direkt
bestellen:

Vom Sinn des Lebens
Oder in der nächstgelegenen
Buchhandlung! So landen die Steuereinnahmen zumindest in
"unserem" Steuersäckel, was theoretisch eine
Investition in Bildung und Erziehung ermöglichen würde.
In Bonn-Bad Godesberg z.B. in der
Parkbuchhandlung