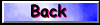Gödde, Günter/Püschel, Edith/ Schneider, Silvia: Psychodynamisch denken lernen. Grundlinien Psychodynamischer Psychotherapie für Ausbildung und Praxis, Psychosozial-Verlag 2022
Der Sammelband dürfte eine Lücke schließen und es wäre wünschbar, wenn dieser Text gründlich von Ausbildungskandidat:innen studiert wird. Die Beiträge sind von unterschiedlicher Art, bemühen sich aber, psychodynamisches Denken transparent, nachvollziehbar und lernbar zu vermitteln. Dabei wird sehr schnell deutlich, dass mensch sich auf einen langen Lernprozess einlassen muss, was Ausbildungskandidat:innen zu Beginn ihrer Ausbildung oft überfordert, manchmal auch mutlos werden lässt, ist doch die Perspektive des psychodynamischen Zugangs zum Menschen nicht mit ein paar Formeln und Techniken der Behandlung möglich, will mensch den Menschen wirklich verstehen, in einen wirklichen Austausch mit ihm eintreten. Das Buch macht Mut, handelt es sich doch nicht um eine Geheimwissenschaft. Es wird die Breite der Einbettung des Zugangs, dessen Wurzeln ja in der Psychoanalyse liegen, deutlich. Der Mensch als soziales Wesen, eingebettet in die ursprüngliche Kultur und in Kontakt mit Menschen aus anderen Kulturen, konfrontiert mit politischen Verhältnissen, umgeben von kulturellen Leistungen in Film, Theater, natur- und geisteswissenschaftlichem Bemühen anderer, ist nicht gut als Maschine zu begreifen oder zu behandeln.
Ein paar Streiflichter sollen das breite Spektrum des vorliegenden Textes beleuchten:
Silvia Schneider eröffnet den Reigen mit einem Beitrag, der in schönster Weise die Nähe eines verstehenden Zugangs zum Menschen zu den geisteswissenschaftlichen Ansätzen verdeutlicht. Da ist eine grundsätzlich offene Haltung erwünscht, sich nicht zu früh festlegen, mehr mit Hypothesen zu arbeiten als mit Feststellungen. Zu finden, nicht zu suchen, wie dies schon Picasso formulierte:
»“Suchen – das ist das Ausgehen von alten Beständen und ein Finden-Wollen von bereits Bekanntem im Neuen. Finden – das ist das völlig Neue! Das Neue auch in der Bewegung [•]. Die Ungewissheit solcher Wagnisse können eigentlich nur jene auf sich nehmen, die sich im Ungeborgenen geborgen wissen, [•] die sich im Dunkeln einem unsichtbaren Stern überlassen [•]. Das ist das Wesenhafte des modernen Menschen, der in aller Angst des Loslassens doch die Gnade des Gehaltenseins im Offenwerden neuer Möglichkeiten erfährt“ (Picasso, zit. n. Gohr, 2006, S. 8)« (S. 29).
Um sich »im Labyrinth«, im zunächst Verwirrenden des doch eigentlich Unbekannten zurecht zu finden, greifen wir in unserer Not auf Theorien zurück. Aber dienen sie nicht vor allem unserer eigenen Sicherheit? Sie sind hilfreich, aber wir dürfen nicht zu ihren Gefangenen werden. Für Schneider hat Therapie im wohl verstandenen Sinne mehr mit Poesie zu tun, weshalb sie für eine »Poetisierung des psychodynamischen Denkens« plädiert. Der Tanz, die Bewegung, besonders die »Mit-Bewegung« (Heisterkamp) derie Therapeut:in ist gefragt. So heißt es denn auch beim Kulturphilosophen Michel de Certeau:
»“Man versteht eine Bewegung, indem man den Tanz mitmacht“« (S. 31).
Die grundsätzlich offene Haltung in der Bewegung hat mehr zu tun mit »Flanieren, Streunen, Herumirren, Zaudern, Warten, Innehalten, Staunen« (S. 32). Soweit Deutungen zum Zuge kommen, sollten sie eher einem Angebot, einem zärtlichen Akt gleichen – auch Konfrontation mit Schmerzlichem kann von Wohlwollen getragen sein und hat eher etwas Zärtliches, Respektvolles – Freud nannte es Takt.
Edith Püschel knüpft nahtlos daran an, wenn sie sich mit dem Abwarten und Eintauchen des Zuhörens beschäftigt. Auch in diesem Beitrag steht das Miterleben, das Lauschen, das zuhörende Sich-Einlassen, das Aufhorchen im Zuhören im Zentrum, aus dem sich Verstehen ergeben kann; es ist dieses aktiv Pathische, dass dem Gegenüber den Raum lässt, an dem wir teilhaben dürfen.
Werner Pohlmann plädiert für eine folgende Haltung, die der Bewegung nachspürt und greift dazu auf die Aufführungspraxis im Theater zurück, also wieder auf die Welt der schönen Künste und ist damit im Feld der Geisteswissenschaften. In Anlehnung an Salber spricht er von den Wirkungen, dem Wirkgeschehen, der sich im therapeutischen Feld entfaltenden Szene.
»Es sind vor allem die Wirkungen der Szene, die Bedeutungen entstehen lassen. Bedeutungen sind, so gesehen, keine feststehenden Inhalte, sondern entwickeln sich aus dem Wirkungszusammenhang, den eine Szene, ob auf der Bühne eines Theaters oder im Behandlungsraum, für alle Beteiligten entstehen lässt« (S. 59).
Teil II befasst sich mit dem Stellenwert der Selbsterfahrung in der Ausbildung. Dazu haben sich die Herausgeber:innen entschlossen, auch Auszubildende oder Absolvent:innen aus jüngerer Zeit zu Wort kommen zu lassen. Hervorzuheben ist der Beitrag von Jann E. Schlimme. Zwar müssen nicht alle Krisen, in die Patient:innen geraten und von denen sie uns erzählen notwendig von uns selbst auch durchlebt worden sein. Jedoch ist es hilfreich, ja notwendig, in der Selbsterfahrung eigene Krisen durchgearbeitet zu haben. Längst haben wir uns – oder sollten es zumindest – vom Bild des Psychiaters – oder Irrenarztes – verabschiedet, wonach ein Gesunder den Kranken behandelt. Schlimme ist mutig genug, seine ins Wahnhafte gesteigerte – und überwundene Krise – mitzuteilen.
Wenn Freud davon sprach, dass die Psychoanalyse in eine lebenslange Selbstanalyse einmünden sollte, so gilt dies für unsere Profession in hohem Maße. Supervision, Intervision, auch die Aufnahme einer therapeutischen Behandlung zur Bearbeitung bislang unentdeckter Engen, sollten selbstverständliche Begleiter unseres Berufslebens sein, ebenso eine lebenslange Lust an der Weiterbildung.
Günter Heisterkamp, dessen Beitrag nicht so recht in diesen Teil des Buches passen mag, schreibt verwundert über die Abwesenheit der Freude in den Mitteilungen über Therapien. Als müsste es immer schwer zugehen, indes es doch gerade die Freude ist, die den Menschen öffnet und weitet, so erst eigentlich Lust auf ein Eintauchen in die Welt der Selbstentfaltung, am Neubeginn, aufkommt. Das gilt durchaus für beide Beteiligte am therapeutischen Prozess, in dem es zu einer »essentiellen Resonanz« kommt.
»Die Formulierung von der „geteilten Freude“ und von der „doppelten Freude“ bleibt noch in einem dualen System, wie letztlich auch der Begriff der Intersubjektivität. Ich spreche hier lieber von einer Wirkungseinheit, in der über das dialektische Wirkungsgeschehen etwas entsteht, das mehr ist als die Summe der isolierten Aktionen und Reaktionen der Beteiligten« (S. 167).
So ließe sich rückschließen, dass die Freude im Feld der vielfachen Möglichkeiten zur Selbsterfahrung nicht fehlen darf, trägt sie doch wesentlich zur Psychohygiene derie Behandler:innen bei.
In Teil III beschäftigten sich die Autor:innen mit den Konzeptualisierungen der unbewussten Dynamik von psychischen Prozessen. Günter Gödde zeichnet die Entwicklung der Konzeptualisierung des Konfliktmodelles innerhalb der psychodynamischen Ansätze nach und geht auf die Systematisierung der OPD ein. Hier hat Eingang gefunden, das Konflikt- und Strukturmodell gemeinsam und sich ergänzend zu betrachten. Das liest sich noch recht angenehm. Ansonsten ist in den Beiträgen die Bemühung um eine Wissenschaftssprache zu spüren, die in Teilen dem naturwissenschaftlichen Duktus zu folgen scheint. Das hebt sich gegen die vorherigen Teile ab, durchzieht die Beiträge doch eine Sachlichkeit, ja Kälte, die den Leser die Techniker:innen am Werke sehen lässt. Glücklicherweise ist das nicht durchgehend der Fall. Frau Scherg etwa zeigt in ihrem Beitrag, dass in der Orientierung am Strukturniveau dem Handlungsdialog eine größere Bedeutung zukommt als der Rede, gar der Deutung. Herr Theis-Abendroth problematisiert die Verdinglichung des Geschehens bei Posttraumatischen Belastungsstörungen. Die PTBS wurde schnell zu einem auf das Physiologische reduzierten Symptomenkomplex, der in seiner scheinbaren Einfachheit verdinglicht wurde. Aus einer Bezeichnung für ein zugrundeliegendes Leiden wurde sie zum Leiden selbst.
»Dazu passt, dass die Vieldeutigkeit korrelierender neuropsychologischer Befunde sowie deren ungesicherter erkenntnistheoretischer Status in der psychotherapeutischen Fachöffentlichkeit oft unbeachtet bleibt1« (S. 226).
Allzu leicht kommt mensch so in Gefahr, sich der tiefen abgründigen Gefühle traumatisierter Menschen zu entziehen und die innere Welt der Hilfesuchenden auszuklammern.
»Ein Versuch, sich dieser Übertragungsdynamik zu entziehen, ist im besten Fall nutzlos, da sie ubiquitär stattfindet und sich sowieso innerhalb wie außerhalb der Therapie manifestiert (Quindeau, 2019, S. 30); im schlimmsten Fall ist ein solcher Ansatz sogar schädlich, weil er das hinter dem „lauernden Trauma“ des manifesten Missbrauchs oft verborgen liegende „leise Trauma“ der Verlassenheit zu wiederholen droht« (S. 227).
Der Kontakt mit existentiellen Themen wie Tod und Lebensrecht und den dazugehörigen möglichen Übertragung-/Gegenübertragunsverstrickungen, fordern die Behandler:innen heraus, aktivieren eigene Ängste, sodass die Dominanz technisierter und manualisierter Therapien als eine Form der institutionalisierten Abwehr aufgefasst werden kann (S. 236).
Wenn in anderen Beiträgen von »Emotionsregulierung« und »Veränderungsmechanismen« die Rede ist, dann zeigt sich in der Sprache wohl die noch nicht verinnerlichte respektvolle Haltung in der Begegnung von Subjekten, wie auch in der Psychoanalyse oft noch die Rede von »Objekten« ist, womit nicht die Wahl der Sitzgelegenheit gemeint ist.
In den folgenden Teilen hat derie Leser:in wieder mehr Anteil am lebendigen Sein, worin ein Ringen um das Verstehen menschlicher Verstrickungen und Tiefen zu spüren ist.
In der Einführung zum IV. Teil wird hinsichtlich des Entwicklungsmodells von Daniel Stern von Phasen gesprochen. Das ist nicht zutreffend, da Phasen durch Anfang und Ende charakterisiert sind. Die Sternschen »Domänen« zeichnen sich dadurch aus, dass zwar zu einem relativ bestimmten Zeitpunkt eine Domäne auftaucht, dann aber ein Leben lang erhalten bleibt und die verschiedenen Domänen miteinander dynamisch interagieren. So stellt es denn auch Petra Schulze Wilmert in ihrem Beitrag dar (S. 325).
Dieter Rau-Luberichs kritisiert in seinem Beitrag die Kognitionslastigkeit im Mentalisierungskonzept. Trotz aller Interpersonalität scheint das Konzept körperlos zu sein, als käme es zu einer Übertragung von einem geistigen Zustand auf den anderen. Rau-Luberichs befasst sich u. a. mit der frühen Bedeutung pränatalen Geschehens, erwähnt die Analytikerin Piontelli (der er konsequent das »t« in ihrem Namen verweigert), die bereits Ultraschalluntersuchungen vornahm und dann intrauterine Bewegungsmuster nachgeburtlich wiederfand. Die spätere, technisch subtilere Forschung mittels 3D Sonographie hat im Kern das Ergebnis, dass es sich bei der Dyade Mutter-Kind eben nicht um eine Einheit handelt, sondern um zwei Organismen in Wechselwirkung.
»Ist für die Körperregulation die Bewegung der Modus des Erlebens und Verinnerlichens, so ist dies für die verkörperte szenische Regulation die Berührung, die auch das facial mirroring, den Austausch von Blicken und Mimik beinhaltet« (S. 380).
Das Thema Berührung ist in der Psychoanalyse tabuisiert. Aufgrund der Forschungen zum Körperselbst sollte erneut über das Thema diskutiert werden. Aber dann unterläuft dem Autor eine Fehlleistung:
»Wir folgen dem Patienten, damit die Gegenübertragung nicht zur Co-Übertragung wird. Aber ist dieses Folgen wirklich möglich, wenn wir die Gesetze des körperlichen Miteinanders [nicht, BK] berücksichtigen [?]« (S. 388).
)
Da scheint Rau-Lubrichs dem Tabu der stärkeren Einbeziehung des physischen Leibes in der Psychoanalyse zu erliegen. So plädiert denn Rau-Luberichs zwar für eine Öffnung des Settings als veränderte Grundregel, »die den Raum des Psychotherapeuten öffnet und Bewegung in ihm als körperliche Assoziationen erlaubt« (S. 388). Aber bitte nur als Assoziation und nur für den Psychotherapeuten, nicht etwa als Ausgangspunkt für ein Bewegungs- oder gar Berührungsangebot oder einer Öffnung des Settings hin zum ganzen Behandlungsraum! Zustimmend zitiert er Fonagy und Target (2006) wenn diese den Sternschen Ansatz referieren:
»Das prozedurale Wissen des impliziten Gedächtnisses wird nur durch Performance zugänglich, das heißt: Es gibt seine Existenz nur zu erkennen, wenn das Individuum eben jene Aktivität ausführt, in die das Wissen eingebettet ist (ebd., S. 353)« (S. 389).
»Es ist erstaunlich, wie wenig das körperliche Miteinander Eingang in die Ausbildung von Psychotherapeuten gefunden hat. Wir sehen: die psychoanalytische Theorie zum Körper und körperlichen Miteinander ist weit fortgeschritten, die Praxis des körperlichen Miteinanders liegt aber zu oft noch auf der Couch« (S. 389).
Es ist noch erstaunlicher, dass jemand, der George Downing als seine Ausbildungsreferenz angibt, weder Moser noch Heisterkamp oder Geißler erwähnt, geschweige denn in der Literaturliste aufführt, Autoren, die »die Praxis des körperlichen Miteinanders« längst von der Couch befreit haben und umfängliches Material zur Handhabung beigesteuert haben.
In Teil V befassen sich die Autor:innen mit dem psychodynamischen Denken in Literatur, Musik, Film, Gruppendynamik und Kulturtheorie. Ein sehr schönes Beispiel für die Anwendung des psychodynamischen Denkens auf die Literatur steuert Hilde Kronberg-Gödde bei. Sie zeichnet das Porträt eines Verantwortungslosen in Francesca Melandris Roman Alle außer mir und kann deutlich machen, dass die subtilen Schilderungen in literarischen Werken eine enorme Bereicherung für unser therapeutisches Wissen darstellen. Mehr als in Vignetten von Therapiebeispielen oder stark abstrahierten fachlichen Darstellungen erfahren wir in diesen Werken detailreiche und Symptom übergreifende Charakterstudien.
Interessant ist ebenfalls der Ansatz von Gabriele Dorrer-Karliova, den Aufbau eines musikalischen Werkes mit der Struktur einer psychotherapeutischen Sitzung in Beziehung zu setzen, etwa der Variationen eines Themas.
Schließlich zeichnet Anne Mauritz das koloniale Erbe im Begriff der »Urhorde« bei Freud nach und verdeutlicht die kulturelle Verfangenheit eines Denkers im Zeitgeist, indes Freud durchaus für sich in Anspruch nehmen kann, ein kritischer Aufklärer gewesen zu sein.
»Während Freud jedoch einerseits das prätentiöse, eurozentristische Denken zu entkräften versuchte, kam zugleich durch die Vorstellung der primitiven Ursprünge der allgemeinen menschlichen Entwicklung das koloniale, rassistische Denken wieder durch die Hintertür in seine Theorie hinein. Auf diese Weise erhielt er genau das aufrecht, was er zu kritisieren versucht. Die emanzipatorische Absicht Freuds scheiterte, weil sie das, was sie kritisierte, gleichzeitig verdeckt beinhaltete (Bickman, 2018, S. 5; Chakkarath, 2021, S. 80)« (S. 478).
Den Abschluss des vorliegenden Werkes bilden Essays zur Psychodynamik des gesellschaftlichen und politischen Lebens. Martin Altmeyer etwa plädiert für die Hinzunahme der sozialen Realität der Patienten als das Dritte in der Therapie, also im therapeutischen Geschehen nicht nur auf innere Konflikte zu fokussieren, sondern die gesellschaftliche Realität in ihren belastenden Strukturen nicht auszublenden – zumindest verstehe ich seinen Beitrag so.
Ruth Großmaß sensibilisiert für die Problematik, diagnostische Zuschreibungen in öffentlichen Diskussionen zu verwenden. Kernberg löste das für sich dahingehend, dass er meinte, Trump nicht diagnostizieren zu wollen, da er nicht beim ihm auf der Couch lag, privat halte er ihn allerdings für einen gefährlichen, rücksichtslosen Psychopathen.
Schließlich sei noch Jürgen Wirth erwähnt, der sich mit der Problematik auseinandersetzt, wenn Patienten in der Therapie populistisches Gedankengut äußern. In einem Therapiebeispiel zeigt er, was dennoch möglich ist, wenn schon eine längere und vertrauensvolle Arbeitsbeziehung besteht. Jedoch
»findet die psychotherapeutische Arbeit häufig dort eine Grenze, wo religiöse oder politische Grundüberzeugungen berührt werden. Solche Überzeugungen zu deuten oder zu problematisieren, wird von Patienten in aller Regel als Übergriff erlebt, weil sie gleichsam zum Kern ihrer Identität gehören« (S. 533).
Im Ganzen ein gelungenes Gemeinschaftswerk, dessen Lektüre auf jeden Fall lohnenswert ist, auch wenn andere Leser:innen andere Schwerpunkte hervorheben würden als ich. Wir können schon gespannt sein auf den angekündigten Nachfolger »Psychodynamisch handeln lernen«.
1 Sogar ein psychodynamisch orientiertes Behandlungsmanual tappt in die reduktionistische Falle und behauptet, die ich-strukturellen Einschränkungen beziehungstraumatisierter Patienten „erklären sich [•] durch eine schwerwiegende Schädigung der emotionsregulierenden kortikalen und limbischen Strukturen des Gehirns“ (Wöller et. al. 2020, S. 10 [Hervorhebung im Original] (Theiss-Abendroth, S. 226).
Bernd Kuck 
Dezember
2022
|
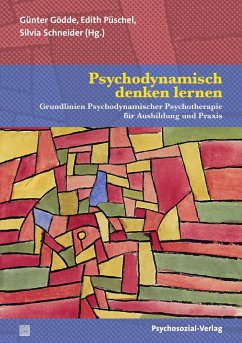
Psychodynamisch denken lernen
|
Oder in der nächstgelegenen
Buchhandlung! So landen die Steuereinnahmen zumindest in
"unserem" Steuersäckel, was theoretisch eine
Investition in Bildung und Erziehung ermöglichen würde.
In Bonn-Bad Godesberg z.B. in der
Parkbuchhandlung

Oder finden Sie hier eine Buchhandlung in
Ihrer Nähe:
Buchhandlung finden
|