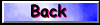Dubiel, Helmut.: Tief im Hirn. Mein Leben mit Parkinson. Goldmann TB München 2008, 157 S., 7,95 €. Erstausgabe, 143 S., Antje Kunstmann Verlag München 2006, 16,90 €.
Morbus Parkinson (Schüttellähmung, Zitterlähmung) ist eine langsam fortschreitende neurodegenerative Demenzerkrankung des extrapyramidal-motorischen Systems. Die Parkinson-Krankheit ist durch das Absterben von Nervenzellen in der Substantia nigra im Mittelhirn und durch den Mangel an Dopamin gekennzeichnet. Zur Definition des Parkinson-Syndroms gehört als Kernsymptom die sogenannte Bradykinese bzw. Akinese (verlangsamte Bewegungen bis Bewegungslosigkeit) zusammen mit wenigstens einem der Leitsymptome: Rigor (Muskelstarre), Ruhetremor (Muskelzittern) und instabiler Körperhaltung (posturale Instabilität). Daneben sind verschiedene sensible, vegetative, psychische und kognitive Störungen möglich. Derzeit leiden in Deutschland zwischen 300.000 und 400.000 Menschen an der Parkinson-Erkrankung – etwa 5% aller Demenzerkrankungen. Meist beginnt die Erkrankung zwischen dem 50. und 62. Lebensjahr, seltener bereits vor dem 50. Lebensjahr (sogenannte Früh-Parkinson).
Zu den Früh-Parkinson-Erkrankten zählt der 2009 emeritierte Professor für Soziologie an der Gießener Universität, Helmut Dubiel, Jg. 1946. Dubiel erkrankte an Morbus Parkinson 1993 im Alter von 46 Jahren. 2006 schilderte er im Buch Tief im Hirn seine Erfahrungen mit der Krankheit und der Tiefen Hirnstimulation durch einen sogenannten Hirnschrittmacher. Nach der Diagnose Parkinson nahm Dubiel täglich viele Tabletten ein, um die Symptome der Krankheit zu bändigen: Das unheimliche Zittern und Zucken, die Muskelversteifungen, anhaltende Schwindelgefühle, die ihm äußerst peinlichen Sprechhemmungen, wenn er unter Menschen war, tiefe Müdigkeit und Erschöpfung, schwere Depressionen und Angstattacken. Sein Bericht gewährt einen persönlichen, ja intimen Einblick in das seelische und körperliche Innenleben eines Parkinson-Erkrankten.
Die Krankheit trifft ihn auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Er studierte Soziologie und Philosophie in Bielefeld und Bochum, war Assistent an der Universität in München, arbeitete am Max-Planck-Institut in Starnberg und war schließlich von 1989 bis 1997 Direktor am Institut für Sozialforschung in Frankfurt am Main, der renommierten Heimstatt der Kritischen Theorie. Gastprofessuren absolvierte er an der University of Berkeley, in Florenz und – nach Ausbruch der Krankheit – drei Jahre lang an der New York University. Angedeutet wird eine Psychotherapie; auch beherrscht er psychoanalytische Ideen und Begriffe.
Dubiel empfindet die Krankheit als die größte Kränkung seines Lebens; er muss sein Leben, wie er sagt, vollkommen uminterpretieren. Bewegungen fallen ihm immer schwerer. Die Mimik gefriert mehr und mehr. Reden wird zur Qual. Dubiel beschreibt zunächst den langen und schmerzhaften Weg, bis er die Krankheit akzeptieren konnte, sowie Absurditäten und schonungslose persönliche und medizinische Details aus seinem Alltag als Parkinsonpatient. Den Leser lässt er ebenso an seiner Verzweiflung teilhaben wie an seinem Mut. Sein Bericht über die Entstehung der unheilbaren Krankheit, die seelischen Folgen sowie die Veränderungen in seinem sozialen Umfeld fällt überaus sachlich aus. Dennoch wird der mit der Krankheit verbundene Schrecken intensiv fühlbar.
Nach der Gastprofessur in New York sieht er zufällig eines Tages in seiner Vorlesung in Gießen, wie Studenten sich über seine unbeherrschte Gestik nachäffend lustig machen. Am gleichen Abend ruft er einen Neurologen an, der ihn über mögliche Operationstechniken informiert. Er lässt sich während einer zehnstündigen Operation einen Hirnschrittmacher einbringen, eine Sonde, die bei vollem Bewusstsein durch ein Loch im Schädel »tief im Hirn« eingesetzt wird. Obwohl er danach den Tablettenkonsum einschränken kann, führt die Sonde zu einem postoperativen Trauma und zu großen Sprechschwierigkeiten. Wie ein unterdrückter Schrei klingt der real erlebte Horror aus Dubiels Schilderungen von Szenen in Operationssälen und Reha-Kliniken nach. Die Sonde lindert zwar die Symptome, hat aber fatale Folgen für seine geistige und seelische Verfassung:
»Dass etwas mit mir geschehen war, merkte ich im Gespräch mit einem Freund. Ich fing plötzlich an zu lallen, ich fing an zu weinen und habe ohne Erklärung das Gespräch abgebrochen. Und diese Symptomatik: Lähmung, Sprachstörung, Depressionen, nahm dann noch zu.«
Mit Unterstützung einer Neurologin findet er heraus, dass er den Apparat zeitweise abschalten kann: Ist der Apparat aus, kann er frei sprechen, muss dafür aber nach kurzer Zeit mit Atemnot, Depressionsschüben und Angstzuständen rechnen.
Dubiel bekennt sich zu seiner Krankheit und versucht, offensiv mit Parkinson umzugehen – was ihm nicht immer leicht fällt. Sein fesselndes Selbstbekenntnis fasziniert bis zur letzten Seite. Es ist klug, persönlich, brillant geschrieben und sehr mutig, ein Lehrstück in Sachen Menschlichkeit. Eberhard Rathgeb von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sieht das Buch von Dubiel als Krankheitsgeschichte eines in den siebziger Jahren sozialisierten, von der Kritischen Theorie geprägten Intellektuellen und erfolgreichen Wissenschaftlers, aber zugleich als Lebensreflexion und Zeitanalyse. So biete das Buch seines Erachtens auch Gelegenheit, eine »theorieaufgeladene Generation beim Nachdenken über den Körper« zu bewegen. Rathgebs Kommentar:
»Selbstredend kennt [Dubiel] sich mit Parkinson jetzt gut aus, denn er hat Tausende von Websites dazu studiert, mit dem theoretischen Autonomiebewusstsein seiner Generation, die auch den Auswüchsen der Expertenkulturen nicht traut. Intellektuelle seiner Generation haben gerne über Methoden und Ansätze von Theorien diskutiert, mit denen der Geist der Gesellschaft sich näherte. Jetzt, wo er gemerkt hat, dass der Geist am Faden des Körpers hängt, denkt Dubiel manchmal auch über Ansätze und Methoden der modernen Medizin nach, die ihm auf seinen Wunsch hin einen Hirnschrittmacher einsetzte, ihn aber damit alles andere als glücklicher gemacht hat. Warum hat er das gemacht? Mit welchem Vertrauen auf was? Vielleicht ist es so: Der Mann mit der Sonde im Kopf weiß keinen Ausweg aus seiner Krankheit – und rebelliert dagegen mit allen modernen technischen Mitteln. Er bleibt damit tief im Hirn ein Kind jenes Jahrzehnts der Intellektuellen, an dessen Anfang in Frankfurt ein berühmtes Institut zur Erforschung der Lebensbedingungen der technisch-wissenschaftlichen Welt gegründet worden ist – gegründet gleichsam als ein Versprechen des theoretischen Geistes, es mit dem Leben aufnehmen zu können« (FAZ 28.2.2006).
»Tief im Hirn« ist ein schonungsloser Bericht über den Wettlauf mit dem Verfall. Mindestens ebenso eindrucksvoll wie die intensive Schilderung der Krankengeschichte ist die tiefe Reflexionsfähigkeit des Autors. Er analysiert die Folgen seiner Krankheit präzise und distanziert, als ginge es dabei nicht um ihn. Wie funktioniert Stigmatisierung? Wo sind die Grenzen medizinischer Technik? Wie verhalten sich Gesunde gegenüber Kranken? Dubiel findet darauf Antworten.
Dr. Robert Ware 
Oktober
2016
-
|

|
Oder in der nächstgelegenen
Buchhandlung! So landen die Steuereinnahmen zumindest in
"unserem" Steuersäckel, was theoretisch eine
Investition in Bildung und Erziehung ermöglichen würde.
In Bonn-Bad Godesberg z.B. in der
Parkbuchhandlung

|